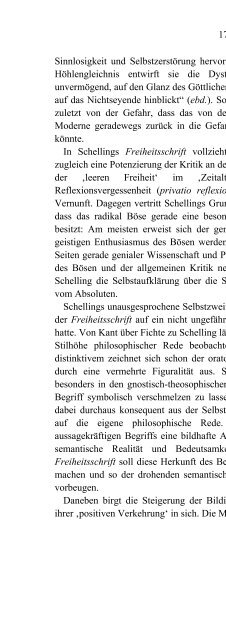II. Fichtes öffentliche Lehre
II. Fichtes öffentliche Lehre
II. Fichtes öffentliche Lehre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
170<br />
Sinnlosigkeit und Selbstzerstörung hervorgehen. In Anspielung auf das platonische<br />
Höhlengleichnis entwirft sie die Dystopie einer Menschheit, deren „Auge,<br />
unvermögend, auf den Glanz des Göttlichen und der Wahrheit hinschauend, … immer<br />
auf das Nichtseyende hinblickt“ (ebd.). So spricht Schellings Rede vom Bösen nicht<br />
zuletzt von der Gefahr, dass das von der antiken Vernunft abgelöste Projekt der<br />
Moderne geradewegs zurück in die Gefangenschaft der platonischen Höhle führen<br />
könnte.<br />
In Schellings Freiheitsschrift vollzieht sich mit der Positivierung des Bösen<br />
zugleich eine Potenzierung der Kritik an der Moderne. Fichte diagnostizierte die Krise<br />
der ‚leeren Freiheit‘ im ‚Zeitalter der Sündhaftigkeit‘ noch als<br />
Reflexionsvergessenheit (privatio reflexionis) und damit lediglich als Mangel an<br />
Vernunft. Dagegen vertritt Schellings Grundfigur der perversio positiva die Einsicht,<br />
dass das radikal Böse gerade eine besondere Affinität zu höchster Intellektualität<br />
besitzt: Am meisten erweist sich der geniale Geist durch das Böse gefährdet. Im<br />
geistigen Enthusiasmus des Bösen werden die dämonischen Abgründe und dunklen<br />
Seiten gerade genialer Wissenschaft und Philosophie sichtbar. Hinter der Metaphysik<br />
des Bösen und der allgemeinen Kritik neuzeitlicher Subjektivität steht deshalb bei<br />
Schelling die Selbstaufklärung über die Selbstgefährdung des Idealismus als <strong>Lehre</strong><br />
vom Absoluten.<br />
Schellings unausgesprochene Selbstzweifel lagen umso näher, weil er sich schon in<br />
der Freiheitsschrift auf ein nicht ungefährliches stilistisches Experiment eingelassen<br />
hatte. Von Kant über Fichte zu Schelling lässt sich nämlich eine stetige Steigerung der<br />
Stilhöhe philosophischer Rede beobachten. Im Unterschied zu Kants nüchterndistinktivem<br />
zeichnet sich schon der oratorische Stil der <strong>öffentliche</strong>n <strong>Lehre</strong> <strong>Fichtes</strong><br />
durch eine vermehrte Figuralität aus. Schellings poetischer Stil beginnt nun –<br />
besonders in den gnostisch-theosophischen Passagen der Freiheitsschrift – Bild und<br />
Begriff symbolisch verschmelzen zu lassen. Dieser neue poetische Stil erklärt sich<br />
dabei durchaus konsequent aus der Selbstanwendung des Grund-Existenz-Theorems<br />
auf die eigene philosophische Rede. Demnach liegt der ‚Existenz‘ jedes<br />
aussagekräftigen Begriffs eine bildhafte Anschauung ‚zu Grunde‘, aus dem er seine<br />
semantische Realität und Bedeutsamkeit bezieht. Der bildkräftige Stil der<br />
Freiheitsschrift soll diese Herkunft des Begriffs aus seinem ‚Grund‘ wieder sichtbar<br />
machen und so der drohenden semantischen Entkräftung der philosophischen Rede<br />
vorbeugen.<br />
Daneben birgt die Steigerung der Bildintensität aber auch zweifellos die Gefahr<br />
ihrer ‚positiven Verkehrung‘ in sich. Die Macht des<br />
{{ Seite 170 }}