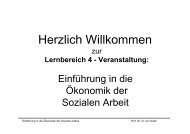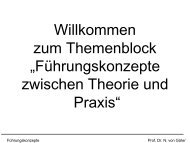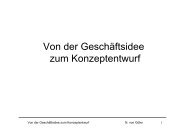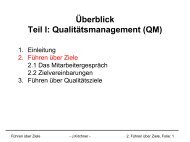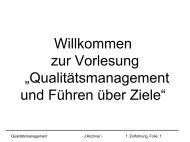Bildungsungleichheiten und Bildungsarmut in Deutschland
Bildungsungleichheiten und Bildungsarmut in Deutschland
Bildungsungleichheiten und Bildungsarmut in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Jugendliche verfügen über soziales Kapital, wenn sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Netzwerk sozialer<br />
Beziehungen aufwachsen/-wuchsen, welches sie dabei unterstützt sozial anerkannte Ziele,<br />
Werte <strong>und</strong> E<strong>in</strong>stellungen zu übernehmen. Dieses soziale Kapital wird hauptsächlich <strong>in</strong> der<br />
Familie, der Verwandtschaft, der Nachbarschaft, <strong>in</strong> religiösen <strong>und</strong> ethnischen Gruppen,<br />
Vere<strong>in</strong>en, Parteien <strong>und</strong> Betrieben gebildet.<br />
Soziales Kapital spielt e<strong>in</strong>e bedeutsame Rolle bei der Bildung von Humankapital (=Schulbzw.<br />
Berufsbildung).<br />
Als Indikatoren für das soziale Kapital der Familie wurden Struktur <strong>und</strong> Größe der Familie<br />
(d.h. Personenzahl, Anzahl der Geschwister, u.a.), der Erwerbstätigkeitsstatus der Eltern <strong>und</strong><br />
verschiedene Aspekte der Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehung (unter anderem der Erziehungsstil oder die<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Hilfe bei Problemen, Schulaufgaben u.a.) erfasst.<br />
2.1.2 Soziale Lage <strong>und</strong> Bildungsniveau der Familien<br />
Die Mehrzahl der <strong>in</strong> der PISA-Studie befragten Jugendlichen <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> lebte zum<br />
Untersuchungszeitpunkt <strong>in</strong> stabilen Familienverhältnissen, d.h. 73 % der Jugendlichen <strong>in</strong> den<br />
neuen B<strong>und</strong>esländern bzw. 77 % der Jugendlichen <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern lebten mit<br />
ihren leiblichen Eltern zusammen. Etwa 16 % der Jugendlichen lebten mit e<strong>in</strong>em alle<strong>in</strong><br />
erziehenden Elternteil zusammen. Die übrigen Jugendlichen lebten größtenteils <strong>in</strong> anderen<br />
Familienformen. Bei allen Familienformen handelte es sich überwiegend um Mehr-K<strong>in</strong>d-<br />
Familien.<br />
Die <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> anzutreffenden Familienmuster s<strong>in</strong>d ähnlich denen <strong>in</strong> anderen<br />
teilnehmenden Industrieländern anzutreffenden Familienmustern. Das gilt sowohl für den<br />
Familientyp <strong>und</strong> die Anzahl der K<strong>in</strong>der als auch für den sozioökonomischen Status <strong>und</strong> die<br />
Erwerbsquoten der Eltern.<br />
Die Bildungsbeteiligung ist e<strong>in</strong>em Strukturwandel von der Generation der Großeltern der<br />
PISA-Teilnehmer zur Elterngeneration der PISA-Teilnehmer unterlaufen. Die Generation der<br />
Eltern profitierte <strong>in</strong> ihrer eigenen Schulzeit von der Bildungsreform, vom Ausbau des<br />
Sek<strong>und</strong>arschulsystems (<strong>in</strong> der BRD) bzw. von der Festigung der Polytechnischen Oberschule<br />
(<strong>in</strong> der DDR). Dieser Strukturwandel wirkte sich auch auf die Generation der PISA-Teilnehmer<br />
aus, <strong>in</strong>dem die erhöhte Bildungsbeteiligung der Eltern (besonders der Mütter) aus Gründen<br />
des Statuserhalts der Familie für e<strong>in</strong>e steigende Bildungsaspiration sorgt (höhere<br />
Erwartungen an die K<strong>in</strong>der). Das bedeutet, dass die K<strong>in</strong>der e<strong>in</strong>en gleichwertigen oder gar<br />
höheren Bildungsabschluss erreichen sollen wie deren Eltern. Etwa 70 % der Eltern der PISA-<br />
Teilnehmer haben m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en Realschulabschluss erreicht. Der mittlere<br />
Schulabschluss setzte sich als faktische Familiennorm durch.<br />
Die sozialen (EGP-) Klassen <strong>in</strong> der Elterngeneration s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>sichtlich des familiären<br />
Bildungsniveaus verschiedenartig. Die Untersuchung ergibt ke<strong>in</strong> Bild von sozial <strong>und</strong><br />
bildungsmäßig e<strong>in</strong>heitlichen Milieus. Es gibt e<strong>in</strong>e bildungsmäßige Durchmischung <strong>in</strong> allen<br />
sozialen Klassen, aber dennoch ist e<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen der Schichtzugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> dem erreichten Bildungsabschluss auffällig. Beispielsweise besitzen etwa 50 % der<br />
Angehörigen der oberen Dienstklasse e<strong>in</strong>en akademischen Abschluss, wobei etwa 60 % der<br />
Arbeiter <strong>und</strong> e<strong>in</strong>fachen Angestellten e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss besitzen.<br />
Bei den Schüler/<strong>in</strong>nen die an der Untersuchung teilgenommen haben hat sich e<strong>in</strong>e klare<br />
schichtspezifische Aufteilung ergeben: K<strong>in</strong>der deren Eltern der oberen Dienstklasse<br />
angehören, haben zu über 50 % Gymnasien besucht, K<strong>in</strong>der deren Eltern den unteren EGP-<br />
Klassen angehören nur zu etwa 15 bzw. 10 %. Für den Hauptschulbesuch sieht die Verteilung<br />
umgekehrt aus. Dagegen ist der Realschulbesuch relativ gleich unter den EGP-Klassen<br />
verteilt.<br />
18