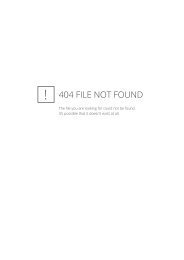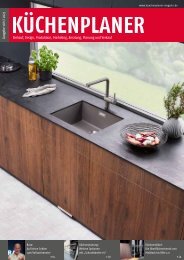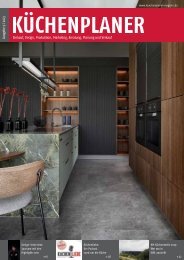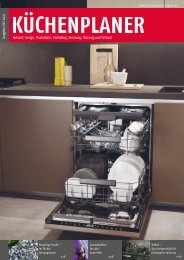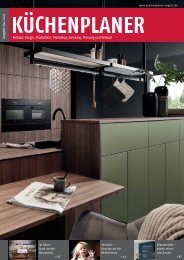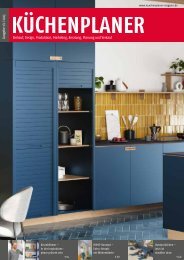IKZ-ENERGY Nr. 10-2013
IKZ-ENERGY AKTUELL - Was bedeutet dezentrale Energieversorgung für die Zukunft? - Ein Bericht über die BATTERY STORAGE in Stuttgart vom 30.9 – 2.10.2013. - „Die Energiewende ist eingeschlafen“ - Licht und Schatten auf der 14. Renexpo in Augsburg. - soNNENENERGIE - Hochleistungs-Vakuumröhren für mehr Energieeffizenz - Gebäudeintegrierte CPC-Vakuumröhren-Kollektoren vereinen mehrere Funktionen. - Einfach drüber schweben - Mini-Helikopter mit Wärmebildkameras werden immer beliebter. - Bessere schadenaufnahme mit Elektrolumineszenz Die mobile Elektrolumineszenz (EL)-Messung ist schnell, verlässlich und preiswert. Solarstrom speichern und bedarfsgerecht verbrauchen Eine kleine Marktübersicht über PV-Batteriespeichersysteme. - Safety first - Normgerechte Montageanleitungen für Solarmodule. Mehrfachnutzen durch intelligente Kombination - Wirtschaftliche Bestandsoptimierung durch Nutzung von Photovoltaik. Leistungen gegen Leistung ... oder wie man den Umsatz nachhaltig steigern kann. - GEoTHERMIE Für einen zuverlässigen Betrieb Geothermische Wärmequelle für den Wärmepumpenprozess.
IKZ-ENERGY AKTUELL - Was bedeutet dezentrale Energieversorgung für die Zukunft? - Ein Bericht über die BATTERY STORAGE in Stuttgart vom 30.9 – 2.10.2013. - „Die Energiewende ist eingeschlafen“ - Licht und Schatten auf der 14. Renexpo in Augsburg. - soNNENENERGIE -
Hochleistungs-Vakuumröhren für mehr Energieeffizenz - Gebäudeintegrierte CPC-Vakuumröhren-Kollektoren vereinen mehrere Funktionen. - Einfach drüber schweben - Mini-Helikopter mit Wärmebildkameras werden immer beliebter. - Bessere schadenaufnahme mit Elektrolumineszenz
Die mobile Elektrolumineszenz (EL)-Messung ist schnell, verlässlich und preiswert. Solarstrom speichern und bedarfsgerecht verbrauchen
Eine kleine Marktübersicht über PV-Batteriespeichersysteme. - Safety first - Normgerechte Montageanleitungen für Solarmodule. Mehrfachnutzen durch intelligente Kombination - Wirtschaftliche Bestandsoptimierung durch Nutzung von Photovoltaik.
Leistungen gegen Leistung ... oder wie man den Umsatz nachhaltig steigern kann. - GEoTHERMIE
Für einen zuverlässigen Betrieb Geothermische Wärmequelle für den Wärmepumpenprozess.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das fuE Power-to-gas<br />
Mit dem Power-to-Gas-Verfahren entwickelte<br />
das Zentrum für Sonnenenergie<br />
und Wasserstoff-Forschung Baden-Würt-<br />
temberg (ZSW), in Zusammenarbeit mit<br />
der Fraunhofer IWES, im Jahr 2009 eine<br />
Technik, die es ermöglichen würde, Strom<br />
aus Erneuerbaren Energieanlagen (EEA)<br />
langfristig zu speichern. Der zugrunde<br />
liegende Sabatierprozess ist alt, die Einbeziehung<br />
der EE zur Biomethanisierung<br />
ist neu.<br />
Das Power-to-Gas-Verfahren nutzt den<br />
produzierten Strom aus Windenergieanlagen,<br />
um das Wasser elektrolytisch in Wasserstoff<br />
und Sauerstoff zu spalten. In einer<br />
anschließenden Synthese mit dem emittierten<br />
CO2 aus den Biogasanlagen wird<br />
Biomethan, mit einem energetischen Wirkungsgrad<br />
> 65 % kWh SNG /kWh el , produziert.<br />
Das Konzept wurde am Fraunhofer<br />
IWES in Kassel und am ZSW – federführend<br />
von Dr. Specht und Dr. Sterner – entwickelt.<br />
Die Firma SolarFuel GmbH baute<br />
im Jahr 2009 auf dem Gelände der ZSW die<br />
Pilotanlage mit einer Anschlussleistung<br />
von 25 kW. In ihr wurde die Synthese des<br />
Erdgassubstituts (Substitute Natural Gas,<br />
SNG) getestet.<br />
Über die Einspeisung in das Erdgasnetz<br />
mit seiner Länge von 370 000 km und einer<br />
Aufnahmekapazität von aktuell bei<br />
217 TWh th und 65 TW th (1 TW = <strong>10</strong>00 GW)<br />
im Zubau entsteht ein enorm großer Langzeitspeicher<br />
für regenerativ erzeugten<br />
Strom – 217 Terrawattstunden thermischer<br />
Energie entsprechen einem Energieverbrauch<br />
von mehreren Monaten. Damit<br />
könnte das bislang im Energiesystem<br />
entkoppelte Transportsystem für elektrische<br />
Energie mit der Gasinfrastruktur<br />
verknüpft werden. Die Rückverstromung<br />
geschieht über KWK-Anlagen, GuD-KWK,<br />
BHKW, GuD-Anlagen. Die Anwendungsfelder<br />
liegen aber nicht nur auf der Rückverstromung,<br />
sondern natürlich auch der<br />
Wärmeversorgung, der industriellen Nutzung<br />
und der Mobilität.<br />
Das Power-to-Gas-Verfahren löst gleich<br />
zwei Kernprobleme der Energiewende. Die<br />
Speicherung von EE und die Versorgung<br />
mit klimafreundlichem Kraftstoff – besonders<br />
für lange Strecken als Ergänzung der<br />
Elektromobilität. Damit wird eine stabile<br />
Stromversorgung mit Wind- und Solar-<br />
energie und eine Option für den Verkehr<br />
möglich.<br />
P2g und Bereitstellung von Energie<br />
Grundsätzlich gibt es drei Verfahren der<br />
Elektrolyse: Die alkalische Elektrolyse, die<br />
Membran-Elektrolyse und die Druck-Elektrolyse.<br />
Das ZSW aus Stuttgart arbeitet mit der<br />
Technik der Druck-Alkali-Wäsche. Ihre Forscher<br />
wollen in einem Konsortium mit dem<br />
Fraunhofer IWES und der SolarFuel die<br />
notwendigen marktwirtschaftlichen Parameter,<br />
wie z. B. die Wirkungsgrad- und<br />
die Kostenoptimierung des Biomethanisierungsverfahrens,<br />
für künftige Powerto-Gas-Anlagen<br />
im Betrieb testen. Energiewirtschaftlich<br />
relevant meint Anlagen<br />
in einer Größenordnung von 1 bis 20 MW.<br />
Hierfür wurde im Oktober 2012, mit einer<br />
Anschlussleistung von 250 KW und einer<br />
möglichen Methanproduktion von bis zu<br />
300 m³ pro Tag, die weltweit größte Powerto-Gas-Anlage<br />
eingeweiht. Mit ihr soll im<br />
Betrieb ein innovatives Prozessleitsystem<br />
für die Steuerung und Regelung für die<br />
Bereitstellung von Regelenergie getestet<br />
werden. „Unsere Forschungsanlage arbeitet<br />
dynamisch und intermittierend. Im Gegensatz<br />
zur ersten Anlage, kann sie flexibel<br />
auf das rasch wechselnde Stromangebot<br />
aus Wind und Sonne und auf plötzliche<br />
Unterbrechungen reagieren“, erklärt Dr.<br />
Michael Specht, Leiter des ZSW-Fachgebiets<br />
Regenerative Energieträger und Verfahren.<br />
Recht schnell registrierten die Forscher,<br />
dass das jetzige Elekrolyseverfahren<br />
für die Wirtschaftlichkeit zukünfiger Anlagen<br />
einer Nachrüstung bedarf.<br />
Auf dem Forschungsgelände arbeiten<br />
seit Anfang Januar <strong>2013</strong> Forscher des<br />
ZSW und Mitarbeiter der Firmen SolarFuel<br />
und Enertrag an diesem zusätzlichen Projekt.<br />
In einem innovativen 300-kW-Druckelektrolyseur<br />
bilden seine 70 Zellen einen<br />
kompakten Stapel. Die Vergrößerung der<br />
Zellenfläche in Verbindung mit einer verbesserten<br />
Elektrodenaktivierung soll zur<br />
www.thermaflex.de<br />
EnErgIEEffIZIEnZ<br />
Speicher<br />
Erhöhung der Gasabgabemenge und des<br />
Wirkungsgrades führen. Die geplante Anlage<br />
fungiert als Demonstrator einer Wasserelektrolyse<br />
im unteren MW-Maßstab einer<br />
Größenordnung, die für Anlagen im<br />
1- bis 20-MW-Bereich notwendig ist. Weitere<br />
Inhalte der Forschungsarbeiten bei<br />
der Elekrolysetechnik gelten der Elekrodenbeschichtung.<br />
Auch eine Analyse potenzieller<br />
CO2-Quellen hinsichtlich Verfügbarkeit,<br />
Erzeugungspotenzial, Wirtschaftlichkeit<br />
und Kosten ist Gegenstand<br />
der F&E-Arbeiten. Wie z. B. das CO2 aus der<br />
Bioethanolherstellung, CCS oder CO2-Re-<br />
cycling, aus Prozessen der chemischen Industrie<br />
oder CO2-Produzenten wie Aluminiumwerke<br />
und Müllverbrennungsanlagen.<br />
Finanziert wird dieses auf drei Jahre<br />
limitierte Vorhaben von dem Bundesministerium<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.<br />
Eine andere Option stellt das Verfahren<br />
mittels des „Protonen Austausch Membran<br />
Elekrolyseur“ (engl. PEM) dar. Die semipermeable<br />
Membran erlaubt die Diffusion<br />
von H+-Ionen, nicht aber die von Anionen.<br />
Die Vorteile gegenüber der alkalischen<br />
genutzten Elekrolysetechnik liegen darin,<br />
dass bei der PEM-Technik eine Feststoffmembran<br />
vorliegt, die ohne Gefahrenstoffe<br />
arbeiten kann. Auch ist mit diesem<br />
Verfahren eine Produktion von über 99 %<br />
reinem Wasserstoff ohne aufwendige Nach-<br />
Reinigung möglich. Die aktuell eingesetzten<br />
Elektrolyseure haben jedoch ein ungünstiges<br />
Preis-Leistungs-Verhältnis und<br />
werden nur in Bereichen von bis zu <strong>10</strong>0 kW<br />
eingesetzt.<br />
Ein Konsortium aus den Industriepartnern<br />
E.on Hanse, Hydrogenics und Solivicore<br />
legte im 2. Quartal <strong>2013</strong>, in Hamburg-Reitbrook,<br />
den Grundstein für eine<br />
Vorbild<br />
Naturkreislauf<br />
Wir freuen uns auf Sie!<br />
SHKG in Leipzig<br />
vom 16. – 18. Oktober <strong>2013</strong><br />
Halle 3 Stand B53<br />
<strong>10</strong>/<strong>2013</strong> <strong>IKZ</strong>-EnErgy 49<br />
®