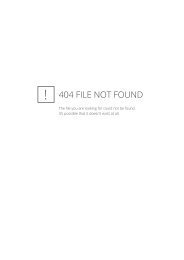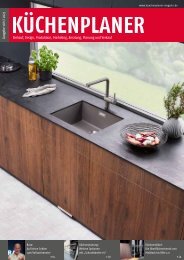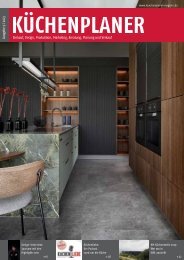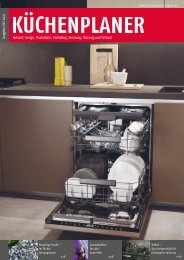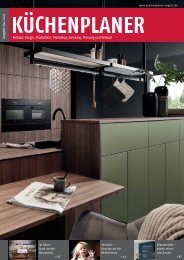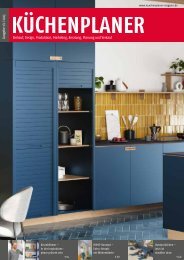IKZ-ENERGY Nr. 10-2013
IKZ-ENERGY AKTUELL - Was bedeutet dezentrale Energieversorgung für die Zukunft? - Ein Bericht über die BATTERY STORAGE in Stuttgart vom 30.9 – 2.10.2013. - „Die Energiewende ist eingeschlafen“ - Licht und Schatten auf der 14. Renexpo in Augsburg. - soNNENENERGIE - Hochleistungs-Vakuumröhren für mehr Energieeffizenz - Gebäudeintegrierte CPC-Vakuumröhren-Kollektoren vereinen mehrere Funktionen. - Einfach drüber schweben - Mini-Helikopter mit Wärmebildkameras werden immer beliebter. - Bessere schadenaufnahme mit Elektrolumineszenz Die mobile Elektrolumineszenz (EL)-Messung ist schnell, verlässlich und preiswert. Solarstrom speichern und bedarfsgerecht verbrauchen Eine kleine Marktübersicht über PV-Batteriespeichersysteme. - Safety first - Normgerechte Montageanleitungen für Solarmodule. Mehrfachnutzen durch intelligente Kombination - Wirtschaftliche Bestandsoptimierung durch Nutzung von Photovoltaik. Leistungen gegen Leistung ... oder wie man den Umsatz nachhaltig steigern kann. - GEoTHERMIE Für einen zuverlässigen Betrieb Geothermische Wärmequelle für den Wärmepumpenprozess.
IKZ-ENERGY AKTUELL - Was bedeutet dezentrale Energieversorgung für die Zukunft? - Ein Bericht über die BATTERY STORAGE in Stuttgart vom 30.9 – 2.10.2013. - „Die Energiewende ist eingeschlafen“ - Licht und Schatten auf der 14. Renexpo in Augsburg. - soNNENENERGIE -
Hochleistungs-Vakuumröhren für mehr Energieeffizenz - Gebäudeintegrierte CPC-Vakuumröhren-Kollektoren vereinen mehrere Funktionen. - Einfach drüber schweben - Mini-Helikopter mit Wärmebildkameras werden immer beliebter. - Bessere schadenaufnahme mit Elektrolumineszenz
Die mobile Elektrolumineszenz (EL)-Messung ist schnell, verlässlich und preiswert. Solarstrom speichern und bedarfsgerecht verbrauchen
Eine kleine Marktübersicht über PV-Batteriespeichersysteme. - Safety first - Normgerechte Montageanleitungen für Solarmodule. Mehrfachnutzen durch intelligente Kombination - Wirtschaftliche Bestandsoptimierung durch Nutzung von Photovoltaik.
Leistungen gegen Leistung ... oder wie man den Umsatz nachhaltig steigern kann. - GEoTHERMIE
Für einen zuverlässigen Betrieb Geothermische Wärmequelle für den Wärmepumpenprozess.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Heizlast von Gebäuden<br />
Raumwärme aus dezentral erneuerbarem Strom<br />
EnErgiEEffiziEnz<br />
Wärme<br />
Die Wärmeversorgung aus dezentral erzeugtem Strom bereitzustellen, ist sicherlich die anspruchsvollste Aufgabenstellung in der<br />
Energietechnik. Dies verlangt eine punktgenaue Integration in die Gebäudesystemtechnik.<br />
Besonders für die Photovoltaik lässt<br />
sich in diesem Fall unsere mitteleuropäische<br />
Klimazone keinesfalls mehr schön reden.<br />
Daher wird der Photovoltaik-Generator<br />
sicherlich nicht die einzige Quelle sein.<br />
Die Anforderungen hinsichtlich des Bedarfs<br />
an elektrischer Energie jedoch sind<br />
identisch. Eine Speicherung von elektrischer<br />
Energie ist für diesen Anwendungsfall<br />
de facto unumgänglich, die Integration<br />
von Kleinst-Windkraft eine sehr<br />
willkommene Ergänzung. Um das Anforderungsprofil<br />
genauer zu bestimmen, ist<br />
die Ermittlung der Heizlast notwendig, um<br />
daraus ein entsprechendes Lastprofil zu generieren.<br />
Dies erfolgt im Rahmen der Heizlastberechnung<br />
nach DIN EN 12 831 als<br />
Basis.<br />
gebäudegröße bzw. raumvolumen<br />
entscheidend<br />
Die Heizlast gibt darüber Auskunft, welche<br />
Wärmeleistung für ein Gebäude bzw.<br />
für einen umbauten Raum notwendig ist,<br />
um bei einer maximal niedrigen Außentemperatur<br />
(Auslegungsfall) eine innere<br />
Raumwärme von 20 °C bzw. 24 °C sicherzustellen.<br />
Die Heizlast gibt also immer einen<br />
Maximalwert an, der für den Auslegungsfall<br />
notwendig ist. Der Auslegungsfall richtet<br />
sich nach drei unterschiedlichen Klimazonen,<br />
wie sie im nationalen Anhang<br />
der Norm mit -14 °C; -16 °C und -18 °C definiert<br />
ist.<br />
Natürlich richtet sich die Heizlast nach<br />
der Größe des Gebäudes bzw. nach dem<br />
gesamten Raumvolumen, den es zu temperieren<br />
gilt. Relevant sind hierfür die<br />
Umschließungsflächen, welche die thermische<br />
Hülle bilden und je nach thermodynamischer<br />
Qualität des Schichtenaufbaus<br />
die Größe der Heizlast in Kilowatt<br />
bestimmt. Vereinfacht dargestellt besteht<br />
die Heizlast aus folgenden zwei Parametern:<br />
• Transmissions-Wärmeverlust durch die<br />
Bauteile der Umschließungsfläche,<br />
• Lüftungs-Wärmeverluste durch Undichtigkeiten,<br />
Luftwechsel und Infiltration.<br />
Seit Einführung der Energieeinsparverordnung<br />
verbesserte sich die energetische<br />
Qualität der thermischen Hülle stetig.<br />
Dies macht sich in einem zeitlichen<br />
Vergleich folgendermaßen bemerkbar:<br />
Während unmittelbar vor der Einführung<br />
der Energieeinsparverordnung auf Basis<br />
eines Niedrigenergiehauses für ein Standard-Einfamilienhaus<br />
mit einer zu beheizenden<br />
Wohnfläche von 160 m² noch eine<br />
Heizlast bis zu <strong>10</strong> Kilowatt notwendig war,<br />
sind es heute – gut 15 Jahre später – nur<br />
noch kaum mehr als die Hälfte, also etwa<br />
5 Kilowatt.<br />
Höhere Luftdichtigkeit von gebäuden<br />
Dies liegt aber nicht nur allein an der<br />
drastischen Verringerung der Transmissions-Wärmeverluste,<br />
sondern auch an<br />
der ebenfalls immer höheren Luftdichtigkeit<br />
von Gebäuden, die ja mittlerweile auch<br />
ein Lüftungskonzept verlangen, um in erster<br />
Linie dem baulichen Feuchteschutz sicherzustellen.<br />
Lüftungsgeräte mit Wärme-<br />
rückgewinnung ermöglichen eine weitere<br />
Reduzierung der Heizlast durch interne<br />
Wärmegewinne, da die Wärme nicht mehr<br />
hinausgelüftet wird, sondern innerhalb der<br />
thermischen Hülle verweilt.<br />
Heizlastbezogene raumliste<br />
Im Rahmen der Heizlastberechnung<br />
wird jeder zu beheizende Raum einzeln<br />
aufgeführt und festgelegt, auf welch eine<br />
Raumtemperatur dieser zu temperieren<br />
ist. Für Wohn- und Aufenthaltsbereiche<br />
gilt dabei 20 °C, für Badezimmer, Duschbäder<br />
und andere Hygieneräume 24 °C.<br />
Für untergeordnete Räume wie Kellerräume<br />
und dergleichen kann eine niedrigere<br />
Raumtemperatur von 18 °C angesetzt werden.<br />
Diese Temperaturdifferenzen zur Außentemperatur<br />
gilt es also zu überwinden.<br />
Die Summe der einzelnen Raum-Heizlasten<br />
ergeben dann die gesamte für das Gebäude<br />
notwendige Heizlast. Diese Aufteilung<br />
ermöglicht somit auch eine Zonierung von<br />
Wärmebereichen innerhalb des Gebäudes,<br />
Die Heizgrenztemperatur entscheidet über die Dauer der Heizperiode. Bild: www.solargrafik.de<br />
<strong>10</strong>/<strong>2013</strong> iKz-EnErgy 51