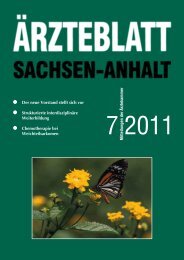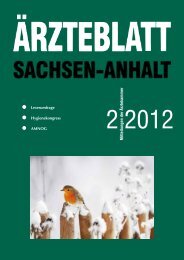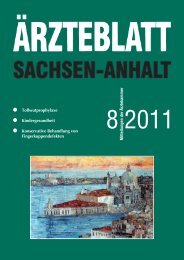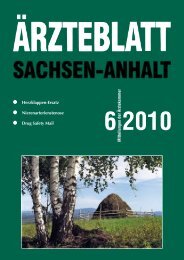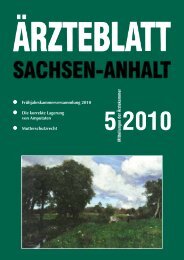Als PDF-Datei herunterladen - Ärztblatt Sachsen-Anhalt
Als PDF-Datei herunterladen - Ärztblatt Sachsen-Anhalt
Als PDF-Datei herunterladen - Ärztblatt Sachsen-Anhalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Was bleibt also bei so häufig vorkommenden ungeklärten<br />
Symptomen zu tun?<br />
Dabei bietet sich das Vorgehen wie in dem im Weiteren<br />
dargestellten Algorithmus an (siehe Abb. 4).<br />
ALGORITHMUS:<br />
Abb. 4: Vom Symptom zur Diagnose am Beispiel der Brustschmerzen.<br />
Algorithmus für die Diagnosestellung der „somatoformen Schmerzstörung“<br />
So bleibt nach sorgfältiger Diagnostik festzuhalten, dass nur<br />
ein sehr geringer Teil der Patienten mit chronischen<br />
Schmerzen unter einer somatoformen Störung leidet. Dies<br />
steht bisherigen Daten entgegen, die beispielsweise eine<br />
Häufigkeit von einem Drittel oder gar 100% aller Patienten<br />
mit chronischen Schmerzen annehmen.<br />
3.2 Diskrepanz<br />
Aus den organisch ungeklärten Symptomen ergibt sich eine<br />
Diskrepanz zum Leiden.<br />
Dabei sind drei Varianten möglich:<br />
3.2.1 Keine körperlichen Symptome.<br />
Dies wurde unter 3.1 bereits beschrieben.<br />
3.2.2 Wenige Symptome, die zur Erklärung der<br />
Beschwerden nicht ausreichen. Neben den unter<br />
3.1 genannten funktionellen Störungen gehören<br />
hierzu die Modekrankheiten wie MCS (Multiple<br />
chemical sensitivity).<br />
3.2.3 Hysterische Erlebnisverarbeitung, weil das Leiden<br />
zu stark angegeben wird.<br />
Zu 3.2.2<br />
Organische Störungen werden durch die Therapie nicht auf<br />
somatoforme Störungen reduziert. In die Schmerzambulanz<br />
kommen hinreichend auch Tumorpatienten. Sie können,<br />
gerade auch wenn die Behandlungsdauer sich trotz der<br />
Chemotherapie hinauszögert, eine Neurose oder eine<br />
entsprechende reaktive Entwicklung haben. So kann es dazu<br />
kommen, dass die Patienten immer mehr Probleme mit dem<br />
Vorhandensein des Tumors bekommen – psychosozial wie<br />
psychisch. Dies geschieht erst recht, wenn der Tumorschmerz<br />
in keiner Weise separat gezielt angegangen wird,<br />
sondern auf sein Verschwinden durch die Behandlung des<br />
Tumors gehofft wird.<br />
Zur Interpretation dieser Situation existieren derzeit 2<br />
Modelle:<br />
a) Die organischen Veränderungen werden durch die<br />
bisherige Therapie (z.B. Chemotherapie) kleiner. Schmerzen<br />
werden allerdings nicht behandelt. Nun kommen die<br />
psychosozialen Probleme, die evtl. auch schon vor der<br />
Veränderung bestanden haben, hinzu und stehen irgendwann<br />
ganz im Vordergrund der Beschwerden. So verlängern<br />
sich womöglich auch die Schmerzen, für die aufgrund der<br />
Chemotherapie kein organisches Korrelat mehr vorhanden<br />
ist.<br />
b) Die Schmerzen werden auch beim Tumor oder anderen<br />
akuten organischen Prozessen nicht adäquat behandelt. So<br />
kann es zur Entstehung eines Schmerzgedächtnisses<br />
kommen. Schließlich kommt es durch die lange Dauer der<br />
Therapie ebenfalls auch zu psychosozialen Problemen, die<br />
irgendwann im Vordergrund stehen können (siehe Abb. 5).<br />
Abb. 5: Chronische Schmerzen/andauernde Schmerzen als Form des<br />
ausgebildeten Schmerzgedächtnisses. Zunächst besteht über die<br />
psychischen wie psychosozialen Bedingungen um das Individuum<br />
herum eine Vulnerabilität/Diathese für den entsprechenden<br />
Umgang mit Schmerzen. Durch Nichtbehandlung der Ursache<br />
kommt es dann zur Ausbildung des Schmerzgedächtnisses.<br />
Ärzteblatt <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong> 22 (2011) 4 65



![PDF-Download [5,3 MB] - Ärzteblatt Sachsen-Anhalt](https://img.yumpu.com/51569066/1/184x260/pdf-download-53-mb-arzteblatt-sachsen-anhalt.jpg?quality=85)
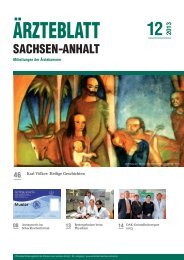

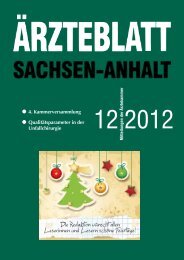


![PDF-Download [4,7 MB] - Ärzteblatt Sachsen-Anhalt](https://img.yumpu.com/40637568/1/184x260/pdf-download-47-mb-arzteblatt-sachsen-anhalt.jpg?quality=85)
![PDF-Download [5,3 MB] - Ärzteblatt Sachsen-Anhalt](https://img.yumpu.com/35451100/1/184x260/pdf-download-53-mb-arzteblatt-sachsen-anhalt.jpg?quality=85)