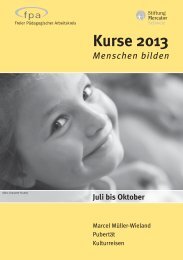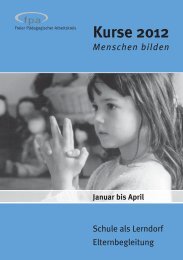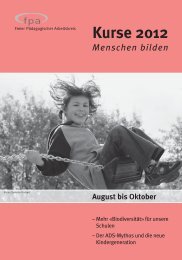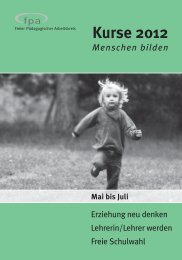Themenheft Schulreife
Themenheft Schulreife
Themenheft Schulreife
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Entwicklung des Wollens im Kopf und endet im Stoffwechsel.<br />
Natürlich spielen sich all diese Prozesse<br />
gleichzeitig in einem Kind ab, die zwei Entwicklungsprozesse<br />
beeinflussen einander gegenseitig. Dennoch<br />
kann man sie unabhängig voneinander beschreiben.<br />
Der Endpunkt der Denkentwicklung ist die Denkreife,<br />
die wir in diesem Heft Lernreife nennen. Der Endpunkt<br />
der Willensentwicklung ist die Willensreife, die wir als<br />
<strong>Schulreife</strong> bezeichnen.<br />
Durch die Tatsache, dass das Denken sich im Laufe der<br />
ersten sieben Jahre zunehmend auf den Kopf konzentriert<br />
und gleichzeitig der untere Pol immer mehr die<br />
Basis für den Willen wird, entsteht dazwischen ein<br />
freier Raum, in der das Fühlen sich entwickeln kann.<br />
Damit ist in diesem Zusammenhang die Fähigkeit der<br />
Seele gemeint, sich mit der Umgebung zu verbinden<br />
und gleichzeitig Abstand zu ihr halten zu können. Es ist<br />
wichtig, die Entwicklung dieses dritten Gebietes, des<br />
Fühlens, als eine selbständige Entwicklung zu sehen<br />
und sie von der der anderen zwei Gebiete, die des Denkens<br />
und des Wollens, zu unterscheiden. Natürlich wird<br />
das Gefühl durch den oberen und den unteren Pol beeinflusst.<br />
Wenn man fit ist und voller Energie für neue<br />
Pläne, fühlt man sich besser als ohne Energie und ohne<br />
neue Pläne. Wenn man keine Vorstellungen und keine<br />
Ideen hat, beeinflusst das das Gefühl anders als wenn<br />
man etwas ganz genau vor sich sieht und weiß, wie<br />
etwas funktioniert. Aber für die Entwicklung zum<br />
freien Menschen, einem lernenden Individuum, ist gerade<br />
der Freiraum zwischen Denken und Wollen essentiell.<br />
Ein Kind begreift etwas erst dann wirklich, wenn<br />
es in sein Gefühl aufgenommen ist. Vielleicht müssen<br />
wir anstatt „reif für die Klasse“ die Bezeichnung „reif,<br />
etwas selbst zu begreifen“ gebrauchen.<br />
Die Entwicklung des Denkens<br />
Denken hängt mit Reflexion zusammen. Auch für den<br />
einfachsten Denkprozess ist eine Spiegelfunktion<br />
nötig, die die Wahrnehmung oder den Denkinhalt reflektiert.<br />
Um in diesen Spiegel etwas sehen zu können,<br />
muss man stillstehen können, einen Standpunkt einnehmen<br />
können. Wir wissen alle, dass aktive Bewegung<br />
einen ruhigen Denkprozess unmöglich macht. Ein Radrennfahrer<br />
ist nach seinem Etappensieg oft nicht<br />
gleich in der Lage, die meist einfachen Fragen eines Reporters<br />
schlagfertig zu beantworten.<br />
Die drei Fähigkeiten des Stillstehens, des Bildschaffens<br />
und der Reflexion wollen wir nun noch näher betrachten.<br />
Der erste Aspekt der Denkentwicklung. Das Stehen.<br />
Am Ende seines ersten Lebensjahres kann das Kind auf<br />
seinen Füssen stehen, frei, aufrecht im Raum. Dazu hat<br />
es sich vorbereitet mit Kriechen, Sitzen, sich Hochziehen<br />
an etwas. Das erste Mal, dass es stehen kann, ist es<br />
ganz stolz, und seine Eltern freuen sich mit ihm. Aber<br />
stabil stehen kann es noch nicht. Sobald es abgelenkt<br />
wird oder sich umdrehen will, fällt es wieder hin. Das<br />
innere Gleichgewicht zu halten, ist eine Kunst, die es<br />
erst mit 2,5 bis 3 Jahren einigermaßen beherrscht. Danach<br />
kann es rennen, tanzen, klettern und Kopfrollen<br />
machen lernen.<br />
Das Stehenlernen bedeutet also auch, innerlich einen<br />
Standpunkt einnehmen zu können, während man sich<br />
bewegt. Die Bewegungen selbst können zunehmend<br />
innerlich beherrscht und schön werden. Für die Denkbewegung<br />
bedeutet das, dass das Kind begreifen<br />
kann, was ihm gesagt wird, ohne in Verwirrung zu geraten.<br />
Der zweite Aspekt der Denkentwicklung. Das Bild.<br />
Im Laufe des zweiten Lebensjahres lernt das Kind<br />
„Sprache“ zu verstehen. Das ist eine große Hilfe etwas<br />
von dem, was rundum geschieht, zu begreifen. Dies ist<br />
eine erste Phase im Zustandekommen eines Bildes.<br />
In der Entwicklung dieses zweiten Aspektes sind drei<br />
Phasen zu unterscheiden.<br />
A) Anfängliche Bilder<br />
Der junge Säugling ist noch ganz aufgenommen in und<br />
ausgeliefert an alle Eindrücke, die auf ihn zu kommen.<br />
Sobald ein Kind stehen kann, kann es die Eindrücke<br />
schon viel ruhiger auf sich einwirken lassen. Es kann<br />
anfangen, sich ein Bild zu machen von dem, was um es<br />
herum vorgeht.<br />
Dazu kommt, dass es langsam anfängt, Sprache zu verstehen.<br />
Das ist eine große Hilfe, die Vorgänge aus der<br />
Umgebung auch begreifen zu lernen. Wenn die Mutter:<br />
„Brei“ sagt, kann das im Kind schon ein innerer Stimmungsbild<br />
von Wohlbehagen hervorrufen: In den Stuhl<br />
gesetzt werden, die Mutter neben sich haben, der süßliche<br />
Geschmack im Mund... dieses „Totalerleben“ hatte<br />
es vorher auch schon, aber das Wort schenkt einen Angriffspunkt<br />
zum Begreifen, es bekommt Bildcharakter.<br />
Durch die Sprache werden die Welt und die Menschen<br />
begreiflich, das Kind ist nicht nur unbewusst in seine<br />
Umgebung aufgenommen; jetzt entstehen Bilder zwischen<br />
dem Kind und der Welt. In Sprache gekleidete<br />
Bilder.<br />
<strong>Schulreife</strong> 21