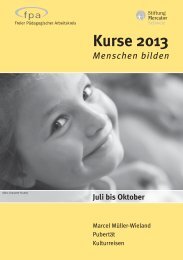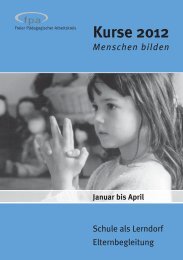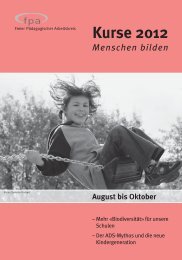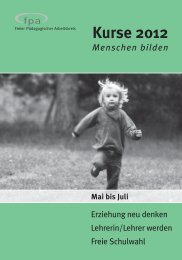Themenheft Schulreife
Themenheft Schulreife
Themenheft Schulreife
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der erste Aspekt der Willensentwicklung:<br />
Wahrnehmen.<br />
An den verschwommenen Augen eines Neugeborenen<br />
kann man sehen, dass es noch nicht in der Lage ist, seinen<br />
Blick zu richten. Heißt das, dass es noch nichts<br />
sieht? Es sieht bestimmt etwas, aber das wird anders<br />
sein, als wir es durch unser gewöhnliches Sehen kennen.<br />
Es sieht aus, als ob das kleine Kind noch träumt, so<br />
wie unser Blick auch nicht auf etwas gerichtet ist,<br />
wenn wir vor uns hin starren. Aber der Säugling starrt<br />
nicht, seine Augen bewegen sich immerhin, als suchten<br />
sie etwas. Vielleicht könnte man sagen: Die Augen werden<br />
noch bewegt. Die Augenbewegungen ähneln den<br />
Bewegungen der Gliedmaßen in dieser Periode, die<br />
„general movements“ genannt werden. Graziöse, tänzerische<br />
Gliederbewegungen, die das Kind später so nie<br />
wieder machen wird. Als würde es durch eine unsichtbare<br />
Kraft bewegt. Dieses Von-außen-bewegt-werden<br />
ist ein Bild, das gut zu der Beeinflussbarkeit eines<br />
Säuglings passt: Alles, was in seiner Umgebung geschieht,<br />
bringt ihn in Bewegung. Es sei denn, er schläft.<br />
Das Sehen fasst zwei entgegengesetzte Bewegungen<br />
zusammen (für die anderen Sinne gilt vergleichsweise<br />
dasselbe):<br />
Es gibt eine nach innen gerichtete und eine nach<br />
außen gerichtete Sehaktivität. Das Neugeborene hat<br />
noch keinen nach außen gerichteten Blick, kann seinen<br />
Blick noch nicht richten. Die Welt schaut in sein Inneres,<br />
und es hat noch kein Bewusstsein von seiner Umgebung.<br />
Erst wenn es lernt, durch seine Augen hindurch<br />
nach außen zu blicken, kann es sehen. In der<br />
Begegnung dieser zwei Sehströme entsteht eine Wahrnehmung.<br />
Bis dahin ist die Wahrnehmung vage, unkontrolliert.<br />
Nach und nach beginnt das Kind zu sehen,<br />
zu erfühlen und zu schmecken, was es zu sehen und zu<br />
ertasten gibt. Wahrnehmen ist also ein aktiver Prozess.<br />
Der Wille ist daran beteiligt. Davor ist die Umwelt nur<br />
Wirkung von außen nach innen. Später wird die Umgebung<br />
wahrgenommene Außenwelt, die mit den Sinnen<br />
erlebt werden kann, also Sinneswelt. Das Üben der<br />
Sinne ist ein lebenslanger Prozess, aber in den ersten 2-<br />
3 Jahren wird der wichtigste Schritt dazu gemacht.<br />
Der zweite Aspekt der Willensentwicklung, Fügen<br />
in drei Phasen dargestellt:<br />
A) Die Wahrnehmungen zeigen sich bedeutungsvoll,<br />
nicht neutral; es geht eine Wirkung von ihnen aus. Was<br />
die Augen sehen, wollen die Händchen ergreifen. Diese<br />
Neigung ist vor allem in den ersten Jahren sehr stark,<br />
keine Ermahnung kommt dagegen an. „Das darfst du<br />
nicht“, „Nicht in den Mund nehmen!“ das führt nicht<br />
zur gewünschten Unterbrechung zwischen Wahrnehmung<br />
und Handlung. Und doch ist es wichtig, dass<br />
diese Unterbrechung gelernt wird. Das Kind muss dazu<br />
heranreifen, auch etwas nicht tun zu können, um nicht<br />
ein durch seinen Instinkt gesteuertes Wesen zu bleiben.<br />
B) Ab 2 bis 3 Jahren wird es normal, das man ein Kind<br />
auch von Weitem durch die Sprache anleiten kann. Die<br />
Sprache hat sich inzwischen zu einem gemeinsamen<br />
Faktor zwischen Eltern und Kind entwickelt und Verbundenheit<br />
geschaffen. Die Sprache kann übrigens<br />
hier auch nonverbal sein, auch Gebärden und Mimik<br />
wirken wie eine Sprache. Kleine Kinder, die nicht mit<br />
derselben Sprache aufgewachsen sind, können dadurch<br />
doch gut miteinander spielen. Das Spiel wird so zu<br />
einem idealen Erzieher in dieser zweiten Phase der Willensentwicklung.<br />
Geben und nehmen, Freude und Leid,<br />
aufbauen und abbrechen, Phantasie und Enttäuschung...<br />
wo kann man das besser lernen als in der<br />
wahren „Als-ob-Welt“ des Spielens? Im Tätig-sein lernt<br />
das Kind, sich zu fügen. Es lernt, seine Wünsche an die<br />
Möglichkeiten anzupassen und seine Pläne zusammen<br />
mit anderen zu realisieren. Bis zum 2,5. Lebensjahr ist<br />
das gemeinsame Spiel noch ein Nebeneinander. Jetzt<br />
wird es zum Miteinander.<br />
C) Vom 4,5. Bis zum 5. Lebensjahr lernt ein Kind, wie es,<br />
eventuell zusammen mit einem anderen Kind, einen<br />
Plan machen kann um dann das gemeinsame Spiel auszuführen.<br />
Der dritte Aspekt der Willensentwicklung im Alter<br />
von 4 2/3 bis 7 Jahren.<br />
Autonomie – Wahrnehmen und Fügen sind nicht die<br />
einzigen Vorbedingungen für die <strong>Schulreife</strong>. Sobald der<br />
Brunnen der Phantasie nicht mehr unbegrenzt quillt,<br />
wird es Zeit sich langweilen zu können. Nichts ist schöner<br />
als ein 6-jähriges Kind, das plötzlich alles Spielen<br />
um sich herum dumm und langweilig findet. Dieser<br />
Moment der Einsamkeit, des Abgetrenntseins vom tragenden<br />
Strom des gemeinsamen Spielens, kündigt<br />
einen neuen Entwicklungsschritt an. Nach einiger Zeit<br />
entstehen dann neue Pläne: zusammen mit Schulkameraden<br />
wird ausgedacht, was man morgen zusammen<br />
machen will. Wer der Anführer der Truppe sein wird, ist<br />
dann eine neue, spannende Frage. Abwechselnd vielleicht?<br />
Die Pläne lösen sich zu Anfang im Eifer des gemeinsamen<br />
Spielens schnell wieder auf, aber zunehmend<br />
soll die Ausführung der Pläne, die gemacht<br />
wurden, auch den Vorstellungen entsprechen, die jetzt<br />
der Wahrnehmung der Wirklichkeit entspringen.<br />
<strong>Schulreife</strong> 23