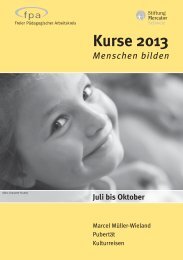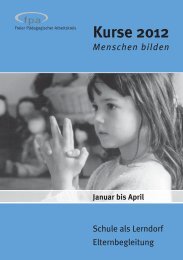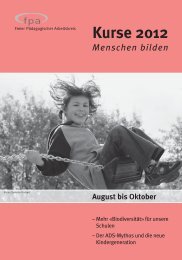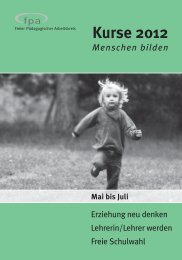Themenheft Schulreife
Themenheft Schulreife
Themenheft Schulreife
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass die Terman-Teilnehmer,<br />
die sehr früh zur Schule kamen, in ihrem<br />
gesamten Leben mit Problemen zu kämpfen hatten.<br />
Zum Beispiel hatten Frühstarter wie Philipp als Erwachsene<br />
eher Anpassungsschwierigkeiten, und<br />
früh startende Mädchen neigten später eher zu Alkoholmissbrauch.<br />
Und überraschenderweise ließ ihr Schuleintrittsalter<br />
zugleich eine Prognose für die Länge ihres<br />
Lebens zu. Die Kinder, die mit fünf Jahren in die<br />
erste Klasse kamen, hatten ein höheres Risiko, früh<br />
zu sterben, und diejenigen, die im Regelalter von<br />
sechs Jahren mit der Schule begannen, lebten länger.<br />
(…) Der frühe Start – seinen Alterskollegen vorauszueilen<br />
– ist ein Mythos, der in die Sackgasse<br />
führt. (S.113)<br />
Faszination und Furcht<br />
– Wegbegleiter der modernen Wirtschaft<br />
Die vorangegangenen Abschnitte versuchten einen<br />
Eindruck zu vermitteln von den widerstreitenden Tendenzen<br />
in der heutigen Elementarpädagogik. Man wird<br />
sich angesichts der Befunde fragen müssen, wie es sein<br />
kann, dass selbst in einem Land wie Deutschland, das<br />
sich stets als Hort von Bildung und Kultur verstand, die<br />
Rattenfängertöne einer wirtschaftsorientierten Politik<br />
derartig starke Wirkung zeitigten und erst allmählich,<br />
nachdem die Konsequenzen in zunehmender Schärfe<br />
sichtbar geworden sind, die Fehlentwicklung erkannt<br />
wird. Warum wacht das Bewusstsein selbst bei denen,<br />
die von Anfang an am wirksamsten hätten Widerstand<br />
leisten können, nämlich Eltern und Pädagogen, so spät<br />
erst auf und hat in der öffentlichen Meinung noch keineswegs<br />
die Oberhand gewonnen? Dazu möchte ich<br />
abschließend noch einige Gedanken skizzieren.<br />
Die sozialdarwinistische These, der Mensch befinde sich<br />
in einem permanenten Kampf ums Dasein, in welchem<br />
er sich behaupten müsse (survival of the fittest), ist<br />
keine Theorie mehr; sie hat sich in unserem gegenwärtigen,<br />
kapitalistisch strukturierten Wirtschafts- und Finanzsystem<br />
so durchgreifend verwirklicht, dass sie wie<br />
eine Art Grundgefühl heutigen Lebens weite Teile der<br />
Menschheit ergriffen hat und ihr Denken, Fühlen und<br />
Handeln bestimmt, unhinterfragt, als handele es sich<br />
um ein unumstößliches Naturgesetz.<br />
Der Alltag scheint dieses Empfinden immer wieder zu<br />
bestätigen. Doch ist den wenigsten bewusst, dass im<br />
Hintergrund zwei gewaltige Mächte am Werk sind, die<br />
uns immer weiter auf dem Weg vorantreiben und sich<br />
gegenseitig die Bälle zuspielen. Sie vereinnahmen den<br />
Menschen nicht auf der Verstandesebene, sondern in<br />
seinem seelischen Befinden, indem sie bestimmte Empfindungen<br />
befördern, die sich einer rationalen Beherrschung<br />
hartnäckig entziehen und eben dadurch einen<br />
hintergründigen Einfluss ausüben: Faszination und<br />
Furcht.<br />
Zahllose Menschen begeistern sich, ja berauschen sich<br />
geradezu an der Rasanz des technischen Fortschritts<br />
mit seinen phantastischen Erfindungen und Entwicklungen,<br />
die noch vor 50 Jahren undenkbar gewesen<br />
wären. Der Rausch ist durchaus begründet: Wer ermessen<br />
kann, welch ungeheure, wahrhaft staunenswerte<br />
Leistungen von Ingenieuren und Wissenschaftlern<br />
immer wieder in kürzester Zeit erbracht werden, der<br />
wird unwillkürlich von der Faszination ergriffen, die<br />
von dem Glanz moderner Technik ausgeht. Aber der<br />
Rausch fördert auch die Begierde nach den neuesten<br />
Hightech-Gütern und -Angeboten, und das befeuert<br />
den Konsum, der die Verbraucher immer mehr in eine<br />
Abhängigkeit führt, bis hin zur Sucht. Die Wirtschaft<br />
„brummt“, wie es volkstümlich heißt; der Konkurrenzkampf<br />
unter den Anbietern steigert sich und erzwingt<br />
ganz selbstverständlich eine fortwährende Steigerung<br />
des Tempos und der Effizienz. Wirtschaftlich überleben<br />
kann nur der, der bei diesem Wettlauf mithält.<br />
Die Geschichte lehrt indessen, dass jedes kapitalistische<br />
System den Grundsatz der Nachhaltigkeit missachtet<br />
und dadurch immer wieder aufs Neue in schwere Krisen<br />
gerät. Wenn eine solche Krise – wie wir es gegenwärtig<br />
erleben – international wird und die gesamte<br />
Welt zu bedrohen beginnt, dann zeigt die andere untergründige<br />
Macht ihr hässliches Gesicht: die Furcht.<br />
Sie ergreift so heftig Besitz von den Gemütern, dass sie<br />
sogar die natürliche Elternliebe korrumpiert und ein<br />
fieberhaftes Bemühen auslöst, die eigenen Kinder<br />
bestmöglich auszurüsten für die erwarteten, immer<br />
heftiger werdenden Krisen der Zukunft, und das so<br />
früh und so schnell wie nur möglich, nach dem Motto:<br />
Je früher, desto besser. Und an diesem Bestreben weiß<br />
die Wirtschaft wiederum trefflich zu verdienen.<br />
Pädagogik im Beschleunigungswahn<br />
Hier macht sich eine Denkweise geltend, die mit dem<br />
technisch-naturwissenschaftlichen Zeitalter heraufgekommen<br />
ist: das lineare Denken, das sich vor allem in<br />
der Leittechnik unserer Zeit, der Computertechnologie,<br />
bewährt hat. Ein Beleg dafür ist das von Moore (Mitbe-<br />
Die Früheinschulungskampagne im Kontext der Bildungsdebatte in Deutschland 9