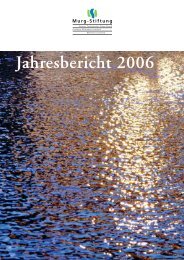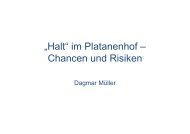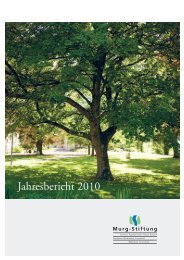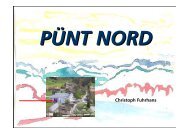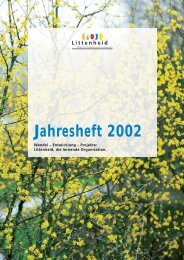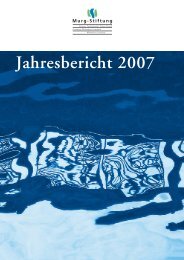Louis Chopard, Stationsleiter Pünt Mitte, Pflegespezialist Höfa IFragen finden statt Antworten geben20Was machen Sie eigentlichberuflich?Wenn wir Pflegefachleute nach unseremBeruf gefragt werden, ist diese Frage häufignicht in einem Satz zu beantworten. Noch schwieriger wird es,wenn wir erklären, dass wir in der Psychiatrie arbeiten. Was istpsychiatrische Krankenpflege, wie sieht sie in der Praxis aus undwas soll sie bewirken? Der folgende Artikel versucht, diese Fragenin mehr als einem Satz zu beantworten. Er gewährt einen Einblickin unsere tägliche Arbeit auf einer offenen Psychotherapiestation.Moderne Pflege bietet dem Patienten unterstützend Möglichkeiten,um sich wieder neu orientiert in der Gesellschaft zurechtzu finden.Psychiatriepflegefachleute begleiten Menschen in Krisen.Lebenskrisen können sehr unterschiedlich aussehen. Hier ein paarBeispiele: Verlust eines geliebten Menschen, längerfristige Arbeitslosigkeit,Depressionen, Suchterkrankungen, Selbstmordgedanken,Sinnkrisen usw.Aus Sicht der Patienten■ Es hilft mir zu wissen, dass Sie an mich glauben.■ Ich schätze Sie als zuverlässigen Gesprächspartner.■ Die klaren Stationsregeln geben mir Halt und Orientierung.■ Mit Ihnen habe ich wieder Lachen können.■ In der Patientengruppe habe ich mich aufgehoben gefühlt.■ Ich durfte mich hier geben, wie ich bin.■ Sie hören mir zu.■ Es ist gut zu wissen, dass ich nicht der einzige Mensch mitsolchen Problemen bin.■ Ich habe mich bei Ihnen nicht bevormundet, sondern gutberaten gefühlt.Die Zitate von Patientinnen und Patienten vermitteln ein erstesGefühl von pflegerischen Wirkfaktoren. Solche Wirkfaktorenkommen nicht zufällig zustande. Sie sind gewollt und werden gezielteingesetzt. Dabei orientiert sich die Pflege an den acht milieutherapeutischenWirkfaktoren.Die acht milieutherapeutischen Wirkfaktoren■ Gruppennormen■ Realitätsbezug■ Interdisziplinarität■ Stationsmilieu■ Gegenwart■ Unabhängigkeit■ Ressourcen■ Kurative Kraft der GruppePraktische Umsetzung der WirkfaktorenMit zwanzig anderen Menschen auf einer Station zu sein,stellt eine aussergewöhnliche Situation dar. Zwanzig Menschenmit unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen.Wie wird der gemeinsame Alltag organisiert, wie dasZusammenleben auf Zeit gestaltet? Die Hausordnung legteinige Regeln des Zusammenlebens auf der Station fest. Sie gibtsomit einen Teil der gewünschten Gruppennorm vor. Mit Hilfeder Hausordnung und der Pflegenden setzt sich die Patientengruppeauseinander. Dabei kommt es schnell zu Meinungsverschiedenheiten,Auseinandersetzungen und Diskussionen unterden Patienten.Jeder Patient reagiert dabei auf seine persönliche Art. Der einezieht sich zurück, ein anderer fängt laut an zu streiten, ein weitererversucht zu vermitteln. Dabei verhalten sich die Patientenmeistens wie sie es auch zu Hause, an ihrem Arbeitsplatz oder imFreundeskreis bei ähnlichen Konflikten tun. Dieses Verhaltenzeigt den Realitätsbezug zum Leben ausserhalb der Station. WelchenÄngsten in der Gruppe ist der einzelne Patient ausgesetzt?Kann und will er sich an dem Konflikt in der Gruppe beteiligen?Welche Erwartungen werden an das Pflegeteam gestellt? Sollen diePflegenden ein Machtwort sprechen oder die Eigenverantwortungder Patienten fördern?In diesem interdisziplinären Geschehen setzt sich die Patientengruppemit der Gruppe der Pflegenden auseinander. Unterpflegerischer Leitung erarbeitet die Patientengruppe gezieltLösungen. Dabei achten die Pflegenden auf eine tragende undwohlwollende Atmosphäre, dem so genannten therapeutischenStationsmilieu. Das Stationsmilieu zeichnet sich dadurch aus, dassalle Patienten gerecht behandelt, geschützt und in ihrer Persönlichkeitrespektiert werden.Das beschriebene Vorgehen findet in der Gegenwart statt.Patienten lernen im «Hier und Jetzt» Probleme anzugehen. Siewerden dabei professionell unterstützt und beraten. Jeder einzelnePatient soll bei diesem Vorgehen seine grösstmögliche Unabhängigkeitbewahren oder erreichen.
Unsere Patienten bestehen natürlich nicht nur aus Problemenund Defiziten. Um Schwierigkeiten zu begegnen, gilt es dieRessourcen, also ihre Stärken und besonderen Fähigkeiten zuberücksichtigen und zu fördern. Gelingt die Lösung des Gruppenkonflikts,wirkt die Gruppe selbst heilend. In einer solchen Gruppemit anderen Menschen, die ein ähnliches Schicksal teilen, fühlensich Patienten aufgehoben und verstanden. Darunterverstehen wir Pflegenden die kurative Kraft der Gruppe.Von der Gruppe zum ZweierkontaktBeim Eintritt bekommt jeder Patient eine Bezugsperson aus derPflege zugeteilt. Diese Bezugsperson begleitet den Patienten währenddes gesamten Aufenthalts auf der Station. Sie ist für die pflegerischePlanung, dieErstellung einer Pflegediagnoseund derenregelmässige Überprüfungverantwortlich.In der Pflegediagnosewird das genaue Problemdes Patienten benannt.Zudem erarbeitetdie Bezugsperson,gemeinsam mit dem«Unsere Patienten bestehennatürlich nicht nuraus Problemen und Defiziten.Um Schwierigkeitenzu begegnen, giltes, die Ressourcen, alsoihre Stärken und besonderenFähigkeiten, zuberücksichtigen und zufördern.»Patienten, die Massnahmen, welche ihm beim Erreichen seinerpersönlichen Ziele helfen. Wie geht das? Zunächst beschreibt derPatient eine Situation, die aus seiner Sicht unbefriedigend verlaufenist.Beispiel: «Wenn ich in so einer grossen Gruppe sitze, bringe ichkein Wort raus. Überhaupt, merke ich, dass ich in den letzten Jahrensolche Situationen immer häufiger vermieden habe. Am Ende habeich mich vollständig zurückgezogen. In meiner Einsamkeit fing ichan, vermehrt Alkohol zu trinken. Bei der Diskussion in der Patientengruppevorhin wäre ich am liebsten rausgelaufen und hätte meinScheissgefühl weggetrunken. Ich weiss nicht, wie lange ich das nochaushalte!» Soweit die vom Patienten beschriebene Situation.Gemeinsam mit der Bezugsperson wird nun eine Verhaltensanalyseerstellt.Die VerhaltensanalyseBei der Verhaltensanalyse geht es in erster Linie darum, die richtigenFragen zu stellen, statt Patentlösungen zu präsentieren. DieFragen können wie folgt aussehen: Welches Gefühl hatten Sie, alsdie Gruppe so hitzig diskutierte? Wann fingen Sie an, sich unwohlzu fühlen? Wann genau wollten Sie weglaufen? Wann kam dieLust, Alkohol zu trinken? Warum sind Sie nicht weggelaufen? Warumhaben Sie keinen Alkohol getrunken?Mit Hilfe dieser Fragen lernt der Patient sein persönliches Verhaltensmusterin Stresssituationen kennen. Er versteht, wann erwie reagiert. Die Bezugsperson verzichtet während der Verhaltensanalyseauf jegliche moralisierenden oder entwertenden Kommentare.Für viele Patienten ist es ungewohnt und oft auch peinlich,über ihre Ängste und Gefühle zu sprechen. Schon hier macht derPatient vielleicht eine grundlegend neue Erfahrung, da die Bezugspersonihn trotz seiner Schwächen akzeptiert.Wie weiter?Durch die Verhaltensanalyse können Patient und Bezugspersondie beschriebenen Gefühle konkret benennen. In dem geschildertenBeispiel spürte der Patient in der Gruppensituation Angst undMinderwertigkeitsgefühle. Er fürchtete, sich in der Gruppe zu blamieren,das Falsche zu sagen und schliesslich von den anderen Patientenabgelehnt zu werden. Um sich vor der vermeintlichen Ablehnungzu schützen, würde er sich am liebsten zurückziehen.Bisher hat er diesen Versagensgefühlen immer nachgegeben, trankgegen das Gefühl der Einsamkeit zunehmend Alkohol. Eine weitereAngst kam hinzu. Seine Familie, seine Freunde und Arbeitskollegendurften nichts von seinem Alkoholproblem erfahren.Noch stärkerer Rückzug und soziale Isolation waren die Folge.Nachdem der Patient Klarheit über diesen «Teufelskreis» erlangthatte, erarbeitete er mit der Bezugsperson seine Wünsche undZiele. Eigentlich ist dieser Patient ein Mensch, der sich sehr denKontakt zu anderen Menschen wünscht und die Gesellschaft andererschätzt. Seine Ziele für den stationären Aufenthalt wurdenwie folgt formuliert:1. Der Patient kann seine Gefühle im Kontakt mit der Bezugspersonangstfrei ausdrücken.2. Der Patient teilt der Patientengruppe mit, wie er sich in solchenSituationen fühlt.3. Der Patient ist in der Lage, mit seinen Angehörigen und fallsnötig mit seinen Freunden und Arbeitskollegen über seineProbleme zu sprechen.4. Der Patient stellt sich, mit Unterstützung der Pflegenden, denihm Angst machenden Situationen.21
- Seite 2: Die 14 Stationen der Klinik Littenh
- Seite 6 und 7: Dr. med. Markus Binswanger, Chefarz
- Seite 8 und 9: Neue Möglichkeiten des Umgangsmit
- Seite 10 und 11: 8«Die Gruppe bleibt dasSchicksal d
- Seite 12 und 13: 10Ablehnung von «Tiefenschwindel»
- Seite 14 und 15: 12besser gelaufen, sie sei eine gut
- Seite 16 und 17: 14■ Der Anteil der Kleinfamilien
- Seite 18 und 19: 16mer wieder am Anschlag, neue Lös
- Seite 20 und 21: 18darf. Psyches Schwestern, zu Besu
- Seite 24 und 25: 22Alle vereinbarten Schritte werden
- Seite 26 und 27: 24Klinik Littenheid teilzunehmen, k
- Seite 28 und 29: 26Therapie der Borderline-Störunge
- Seite 30 und 31: 28eine atypische, persönlichkeitsb
- Seite 32 und 33: Noori Beg, Klinische Psychologin Ju
- Seite 34 und 35: 32zwischen innen und aussen, zwisch
- Seite 36 und 37: 34sen. Mit all den vom Jugendlichen
- Seite 38 und 39: François Gremaud, Klinischer Psych
- Seite 40 und 41: Die Defizit-Theorie des Alters hata
- Seite 42 und 43: 40 wird. Es geht nicht mehr um das
- Seite 44 und 45: Raymond Scheer, Bereichsleiter Pfle
- Seite 46 und 47: Dr. med. Jokica Vrgoc, Leitende Är
- Seite 48 und 49: NachleseBeiträge ausserhalb unsere
- Seite 50 und 51: 48 ein wahrer Erzähler nimmt sein
- Seite 52 und 53: Auswertung PoC 18 pro Quartal, Gesa
- Seite 54 und 55: Eintritte nach Kantonen 1998-2002Di
- Seite 56 und 57: Wir gratulieren54Dienstjubiläen 20
- Seite 59 und 60: Der Patient als PartnerUnsere Klini