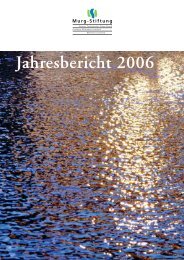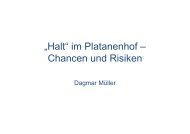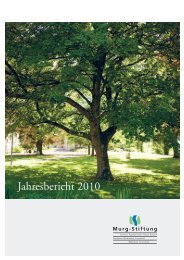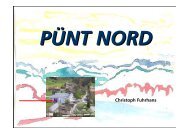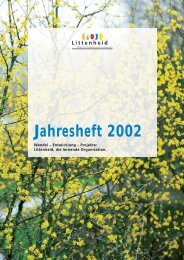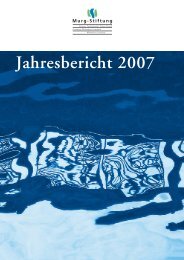Jahresheft 2003 - Murg Stiftung
Jahresheft 2003 - Murg Stiftung
Jahresheft 2003 - Murg Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Entlastung für das Selbst («so bin ich es los»). Im Krieg werdendadurch in hohem Masse eigene, ungelöste Konflikte sowie eigeneAngst und Unfähigkeit im Anderen bekämpft und abgetötet.b) Die Bedeutung der angestauten Aggressionen, externalisierteProjektionenViele Psychiater vertreten die Meinung, der angestaute Aggressionstriebsei verantwortlich für Krieg, da Krieg eine Art Aggressionsventildarstellt und die Aggression das Instrument des Kriegesist. Der Krieg ist nicht die Folge der Aggressionen, sondern dieKonflikte sind es, die die Aggressionen auslösen. Die im Lebenangesammelten Frustrationen beinhalten Aggressionen, die gegenden «Feind» und für die Bekämpfung des «Bösen» mit Hilfe derKriegspropaganda kanalisiert wird. Das «Böse» liegt im Feind, derreal ist und vernichtet werden soll. Je ferner, je unbekannter, jefremder der Gegner, desto leichter ist diese Ausschaltung zu erreichen.Eine der schwierigsten Aufgaben der psychologischenKriegsführung besteht darin, die natürlichen Gefühle der Menschlichkeitauszuschalten, damit die «Kriegsmoral» nicht beeinträchtigtwird. Die Ausbildung von Elitesoldaten beinhaltet zahlreicheMethoden zur Immunisierung von Mitgefühl und Mitleid gegenüberden Opfern.c) Wir-GefühlIm Laufe unserer Integration lernen wir im Prozess der Selbsterweiterung«Wir – das erweiterte Selbst». Das Wir-Gefühl isteine schöpferische Aufhebung von Gegensätzen sowie eine beidseitigeStärkung und Stabilisierung der beteiligten Personen. ImKrieg entwickeln die Soldaten durch eine Wir-Bildung intensivegegenseitige Beziehungen, Treue und Solidarität. Die Bedeutungder Nationalzugehörigkeit ist für den Krieg ebenfalls von grosserBedeutung. Hier kommt das Gefühl der Gemeinsamkeit, der Ähnlichkeitund der Zusammengehörigkeit ins Spiel, das auf gemeinsamenWesenszügen, gemeinsamer Geschichte, Sprache, Kulturund Selbstdefinition beruht. Die zahlreichen weiteren Gefühle wieparanoide Ängste, Schuldgefühle usw. spielen in der Psychodynamikdes Krieges eine grosse Rolle, auf die ich leider hier nicht weitereingehen kann.Die Bedeutung des Krieges im klinischen AlltagAls serbokroatisch sprechende Ärztin betreue ich häufig Patientenaus dem ehemaligen Jugoslawien. An Hand eines Beispiels möchteich gerne die Auswirkung des Krieges in Ex-Jugoslawien auf die inder Schweiz lebenden Gastarbeiter aufführen.Ein 45-jähriger Bosnier wird wegen persistierender diffuserSchmerzen bei Verdacht auf somatoforme- und Schmerzstörung indie Klinik eingewiesen. Die Beschwerden begannen 1995 schleichendund nahmen zu, so dass er seit 2002 zu 100% arbeitsunfähigist. In der Therapie stellte sich folgende Problematik heraus: Erarbeitete seit 1986 als Hilfsarbeiter und galt als ein sehr einsatzfreudiger,zuverlässiger und treuer Mitarbeiter. Monatlich reiste ernach Hause, kümmerte sich um seine Familie, baute ein Haus inseinem Dorf und fühlte sich erfolgreich. Der Familie ermöglichteer durch sein Einkommen soziale Sicherheit und einen besserensozialen Status. Diese Leistung wurde von der Familie anerkanntund geschätzt, was sich sehr positiv auf sein Selbstwertgefühl auswirkte.So konnte er die tägliche Erniedrigung (Bahnhilfsarbeiter,unzählige Überstunden) zu Gunsten eines guten Verdienstes kompensieren.Das Haus, das er in seiner Heimat baute, war «seinBeweis für seinen Erfolg im Ausland und sein wahrer Stolz» undverschaffte ihm die Anerkennung der Dorfbewohner. 1992 wandertedie Ehefrau mit den Kindern wegen des Krieges in Bosnienin die Schweiz ein. Das Zusammenleben beanspruchte neueAnpassungen von allen Familienmitgliedern und er war mit derIntegration der Familie durch die mangelnden Sprachkenntnissehäufig überfordert. Auch die Kinder mussten den Vater oft als hilfloswahrnehmen, was sein Selbstwertgefühl sehr gefährdete. ImKrieg wurde das Haus geplündert und seine Eltern und Geschwistervertrieben. Die Eltern starben einige Jahre danach als Flüchtlingein einer kleinen bosnischen Stadt. Viele Angehörige warenauf seine Hilfe und Unterstützung angewiesen, was eine zusätzlicheBelastung und einen zusätzlichen Druck darstellte. Über Jahrekonnte er sein Dorf und sein Haus nicht mehr besuchen. DieUrlaube machten ihm keine Freude mehr, im Gegenteil, er wartraurig, die Erinnerungen an die schönen Zeiten taten ihm sehrweh. Die Hoffnung, eines Tages zurückkehren zu können,schwand langsam, da dies auch nach acht Jahren immer noch aussichtsloswar. Die Träume, ein eigenes kleines Geschäft (Autowaschanlage)zu gründen, wurden begraben. Die Entwurzelungbesteht jetzt nicht nur hier, sondern auch in seiner Heimat, da ersein Haus und somit seinen Halt verloren hat. Auf seine Heimatund seine eigenen Leistungen war er zuvor sehr stolz gewesen. DieVerlustgefühle und Enttäuschungen durch den Verlust der eigenenHeimat (Nation) sind für ihn sehr schmerzhaft und machen ihntrostlos. Der Alltagsdruck ist praktisch nicht mehr kompensierbar.Die Kinder integrieren sich in die schweizerische Gesellschaft,haben eine andere Lebenshaltung und andere Vorstellungen, diemit den seinen sehr stark divergieren. Sie gehen ihre eigenen Wegeund die Bedeutung der Heimat wird schwächer. Die innerlicheHilflosigkeit ist unerträglich, einen Ausweg sieht er kaum. «Wosoll ich meine Kraft schöpfen und für welche Ziele arbeite ich mitgleichem Elan weiter?», fragt er sich täglich. «Es ist alles so hoffnungslos.»Bezüglich der Suche nach einer neuen Heimat ist sichdas Ehepaar uneinig. Er ist natur- und tierverbunden und möchtegerne in einem Dorf, seine Frau lieber in einer Stadt leben. Dieunbewusste Flucht in die Krankheit bietet eine vorübergehendeScheinentlastung für sein Selbst, aber der Arbeitgeber wird ungeduldigund die Stelle wird ihm gekündigt.Die Menschen haben über Jahrtausende hinweg durch denKrieg nicht nur ihre Interessenkonflikte zu lösen versucht, sonderngleichzeitig mit ihrer Existenz ihre Wertsysteme geprägt, ihre innerenKonflikte externalisiert, ihre Defizite aufgrund überhöhterSelbsteinschätzung und mangelnden Einfühlungsvermögens fürandere kompensiert, ihre Heldenideale geformt und ihre Sinnlosigkeitsgefühleüberspielt. Ist die Globalisierung die Chance fürdie «Denationalisierung» und bietet sie eventuell eine Prophylaxegegen den Krieg? Prof. Stavros Mentzos meint: Es ist keine Denationalisierungper se zu wünschen, sondern eine Balance, innerhalbderer die jeweils anzustrebende dialektisch-integrativeLösung der Konflikte zur Entstehung von echter und schöpferischerWir-Bildung führen würde.«Wenn du Frieden willst, erforsche den Krieg», sagte Spiellmann1987. Will man den Frieden, dann muss man insbesonderedie psychosoziale Funktion, die bislang der Krieg erfüllte, aufandere Weise ermöglichen und dadurch die Funktion des Kriegesüberflüssig machen.45