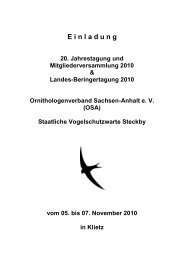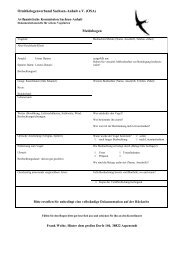Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2009 - Ornithologenverband ...
Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2009 - Ornithologenverband ...
Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2009 - Ornithologenverband ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Als weitere für viele Arten habitatverbessernde<br />
Maßnahmen s<strong>in</strong>d die <strong>in</strong> den letzten Jahren durchgeführten<br />
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für<br />
den Ausbau des Mittellandkanals zu nennen. Besondere<br />
Bedeutung hat dabei die Errichtung e<strong>in</strong>es<br />
Flachwasserbiotops nordwestlich von Mannhausen,<br />
der als Nahrungshabitat vom Seeadler<br />
angenommen wird und Bruthabitat unter anderem<br />
von Kiebitz und Graugans darstellt.<br />
Bei der aktuellen Kartierung im Jahr <strong>2009</strong> wurden<br />
<strong>in</strong>sgesamt 11 Greifvogelarten registriert. E<strong>in</strong> guter<br />
Erhaltungszustand konnte dabei für Wespenbussard,<br />
Habicht, Sperber, Rot- und Schwarzmilan<br />
sowie den Seeadler festgestellt werden. Diese Arten<br />
weisen weitgehend stabile Brutbestände auf.<br />
Zur Sicherung der Populationen ist der Erhalt der<br />
Altholzbestände erforderlich. Unmittelbare Gefährdungen<br />
dieser Arten s<strong>in</strong>d derzeit nicht bekannt,<br />
wenngleich der Sperber und der Seeadler mit<br />
jeweils nur e<strong>in</strong>em Brutpaar im Vogelschutzgebiet<br />
vertreten s<strong>in</strong>d. Die Ausweisung des Breitenroder-<br />
Oebisfelder Dröml<strong>in</strong>gs als Totalreservatsfläche<br />
kommt dem störungsempf<strong>in</strong>dlichen Seeadler<br />
zugute. Der Erhaltungszustand von Mäusebussard<br />
und Baumfalke wird als hervorragend e<strong>in</strong>gestuft,<br />
da die Werte der Siedlungsdichten dieser<br />
Arten hier vergleichsweise hoch s<strong>in</strong>d. Beim Baumfalken<br />
erfolgte <strong>in</strong> den letzten Jahren sogar e<strong>in</strong><br />
Bestandsanstieg. E<strong>in</strong> deutlicher Bestandsrückgang<br />
ließ sich h<strong>in</strong>gegen bei der Rohrweihe feststellen,<br />
deren Nistmöglichkeiten im EU SPA durch<br />
das Fehlen größerer Schilfröhrichtbestände sehr<br />
beschränkt s<strong>in</strong>d. Der Bestandsrückgang der letzten<br />
Jahre ist durch zunehmende Prädation durch<br />
Neozoen (Waschbär sowie Marderhund) und im<br />
Bestand zunehmende heimische Prädatoren, wie<br />
Rotfuchs, Dachs oder Wildschwe<strong>in</strong> erklärbar, wobei<br />
repräsentative Angaben zum Bruterfolg und<br />
den tatsächlichen Prädationsverhältnissen fehlen.<br />
Auch die ger<strong>in</strong>ge Feldmausdichte im Untersuchungsjahr<br />
mag e<strong>in</strong> Grund für die aktuell ger<strong>in</strong>ge<br />
Besiedlung durch die Rohrweihe se<strong>in</strong>. Der Erhaltungszustand<br />
der Art wird als mittel bis schlecht<br />
e<strong>in</strong>gestuft. Die nicht alljährlich im Vogelschutzgebiet<br />
brütende Wiesenweihe ist vor allem durch<br />
Ausmähen der Horste bei der Getreideernte, die<br />
meist vor dem Flüggewerden der Jungvögel erfolgt,<br />
gefährdet. Der Bruterfolg hängt damit sehr<br />
stark von der Errichtung von Nestschutzzonen ab.<br />
Der Erhaltungszustand dieser Art ist ebenfalls als<br />
mittel bis schlecht e<strong>in</strong>zustufen. In e<strong>in</strong>er vergleichsweise<br />
ger<strong>in</strong>gen Dichte kommt der Turmfalke<br />
im Untersuchungsgebiet vor. Auch der Erhaltungszustand<br />
dieser Greifvogelart wird als mittel<br />
bis schlecht e<strong>in</strong>geschätzt.<br />
Als typische Waldvogelarten des Vogelschutzgebietes<br />
s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> Schwarzspecht und Mittelspecht<br />
zu nennen. Für beide Arten ist e<strong>in</strong>e Bestandszunahme<br />
nachweisbar. Die Ausstattung<br />
des Vogelschutzgebietes mit potenziellen Lebensräumen<br />
dieser höhlenbauenden Spechtar-<br />
ten lässt noch weitere Ansiedlungen zu. Der Erhaltungszustand<br />
des Schwarzspechtes wird als<br />
hervorragend e<strong>in</strong>gestuft, der des Mittelspechtes<br />
aufgrund se<strong>in</strong>er derzeit noch ger<strong>in</strong>gen Siedlungsdichte<br />
als gut.<br />
Das Vogelschutzgebiet bietet nur e<strong>in</strong>e begrenzte<br />
Zahl an potenziellen Nistmöglichkeiten für die<br />
Schleiereule. Die durch die Naturparkverwaltung<br />
e<strong>in</strong>gerichteten und jährlich betreuten Nisthilfen<br />
gleichen den Höhlenmangel des Gebietes nur<br />
teilweise aus. Aufgrund guter Bruterfolge kann für<br />
das EU SPA e<strong>in</strong> guter Erhaltungszustand für diese<br />
Art festgestellt werden.<br />
Der Pirol stellt e<strong>in</strong>e Charakterart des Dröml<strong>in</strong>gs<br />
dar, dessen Bestand aufgrund von nachgewiesenem<br />
Anstieg und hoher Siedlungsdichte derzeit<br />
e<strong>in</strong>en hervorragenden Erhaltungszustand aufweist.<br />
Beim Schlagschwirl ist von e<strong>in</strong>em stabilen Bestand<br />
auszugehen. Die höchsten Dichten werden<br />
<strong>in</strong> den ungestörten Totalreservatsgebieten erreicht.<br />
Der Erhaltungszustand der Art ist hervorragend.<br />
Trotz der schlechten Reproduktionswerte des<br />
Weißstorchs im Erfassungsjahr <strong>2009</strong> wird für diese<br />
Großvogelart e<strong>in</strong> guter Erhaltungszustand angenommen.<br />
Zum Erhalt der Art tragen maßgeblich<br />
die Extensivierung geeigneter Feuchtgrünlandflächen<br />
sowie die Errichtung von Flachwasserbereichen<br />
<strong>in</strong> unmittelbarer Umgebung von<br />
bereits geschaffenen Horstplattformen im Rahmen<br />
des erwähnten Weißstorchschutzprojektes bei.<br />
In den letzten Jahren haben sich die Bed<strong>in</strong>gungen<br />
für Wiesenbrüter wie Wiesenweihe, Wachtelkönig,<br />
Sumpfohreule, Kiebitz, den Großen<br />
Brachvogel, Braunkehlchen und Wiesenpieper<br />
sowie Rebhuhn und Wachtel durch extensivere<br />
Bewirtschaftung der Flächen verbessert. Als problematisch<br />
für viele Arten erweist sich aber der<br />
hohe Prädationsdruck. Der Erhaltungszustand der<br />
Arten wird als mittel bis schlecht e<strong>in</strong>gestuft.<br />
Lediglich für den Kiebitzbestand liegt e<strong>in</strong> guter<br />
Erhaltungszustand vor, da verschiedene biotopgestaltende<br />
Maßnahmen (vor allem die Neuanlage<br />
von Flachgewässern) durch die Kiebitze gut<br />
angenommen werden. Viele Nestmulden dieser<br />
Vogelart werden jedoch auf ackerbaulich genutzten<br />
Flächen angelegt, auf denen e<strong>in</strong>e hohe Verlustrate<br />
zu verzeichnen ist. Auch der lediglich als<br />
unregelmäßiger Brutvogel e<strong>in</strong>zustufende Wachtelkönig<br />
brütete im Kartierungsjahr nicht auf den<br />
Grünlandflächen des Untersuchungsgebietes. Die<br />
3 ermittelten Reviere befanden sich stattdessen<br />
<strong>in</strong> den ungenutzten Totalreservatsbereichen des<br />
Breitenroder-Oebisfelder Dröml<strong>in</strong>gs. Der anhaltende<br />
Bestandsrückgang des Großen Brachvogels<br />
lässt sich vermutlich nur durch aufwendiges Management<br />
(Nutzungse<strong>in</strong>schränkungen an den<br />
jährlich zu suchenden Neststandorten, Prädatorenreduktion,<br />
Nestschutz) aufhalten. Die rückläufigen<br />
Bestände von Braunkehlchen und Wiesen-<br />
51