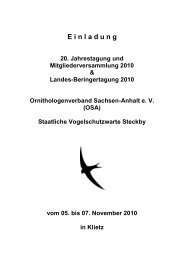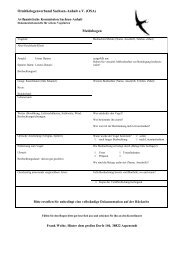Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2009 - Ornithologenverband ...
Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2009 - Ornithologenverband ...
Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2009 - Ornithologenverband ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Rohrweihe f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> den Wiesen rund um das<br />
Bürgerholz und entlang des Elbe-Havel-Kanals offensichtlich<br />
noch genügend Nahrung. Limitierend<br />
dürften die fehlenden Brutmöglichkeiten wirken.<br />
Der Mittelspecht hat im Bürgerholz e<strong>in</strong>en optimalen<br />
Bestand. Wird die Verordnung zum Naturschutzgebiet<br />
konsequent e<strong>in</strong>gehalten, ist nicht<br />
mit Bestandse<strong>in</strong>bußen zu rechnen. Die Siedlungsdichte<br />
des Schwarzspechts ist sehr hoch (0,83<br />
Reviere/km²) und entspricht dem höchsten <strong>in</strong> der<br />
Literatur angegebenem Wert von bis zu 0,83 Rev./<br />
km² aus den Urwäldern des Balkans (BAUER et al.<br />
2005). Diese (allerd<strong>in</strong>gs nur auf e<strong>in</strong>er vergleichsweise<br />
kle<strong>in</strong>en Fläche ermittelte) Abundanz<br />
spiegelt die Naturnähe des Gebietes wieder.<br />
Die Heidelerche siedelt an der Nordgrenze des<br />
Schutzgebietes. Es handelt sich hier um e<strong>in</strong>e höher<br />
gelegene trockene Kuppe. Ob das Vorkommen<br />
e<strong>in</strong>e Zukunft hat, hängt davon ab, ob die Fläche<br />
offen gehalten werden kann oder zuwachsen wird.<br />
Die Sperbergrasmücke wird mittelfristig aus dem<br />
Gebiet verschw<strong>in</strong>den, da die Fläche der natürlichen<br />
Sukzession unterliegt.<br />
Der Neuntöter dürfte im Gebiet weiterh<strong>in</strong> entsprechende<br />
Brutmöglichkeit f<strong>in</strong>den. Wichtig ist e<strong>in</strong>e<br />
nicht zu <strong>in</strong>tensive Landnutzung <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit<br />
dem Erhalt der vorhandenen Hecken.<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden,<br />
dass das Bürgerholz noch e<strong>in</strong>en naturnahen Zustand<br />
aufweist. Allerd<strong>in</strong>gs dürfen ke<strong>in</strong>e weiteren<br />
Grundwasserabsenkungen erfolgen. Die Bewirtschaftung<br />
des Grünlandes, besonders im Nordosten<br />
(Kan<strong>in</strong>chenhau), muss extensiv erfolgen.<br />
Bäume sollten grundsätzlich ausgekoppelt werden.<br />
E<strong>in</strong>e Erhöhung des Wasserstandes <strong>in</strong> den<br />
Erlenbrüchen und Wiesengebieten ist aus ornithologischer<br />
Sicht anzustreben und würde zu e<strong>in</strong>er<br />
Verbesserung der hydrologischen Gesamtsituation<br />
führen. Bei entsprechend höheren Wasserständen<br />
(z. B. wie 2003) brütete die Bekass<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Paaren <strong>in</strong> den feuchteren Wiesenbereichen.<br />
Auch der Schreiadler konnte im selben<br />
Jahr balzend nachgewiesen werden. Seither erfolgte<br />
e<strong>in</strong>e auffällige Absenkung des Wasserspiegels.<br />
U. a. wurde im Ostbereich e<strong>in</strong> Wehr zerstört,<br />
das die AG Kranichschutz errichtet hatte.<br />
2. FFH-Gebiet Güsener Niederwald<br />
Gebietsbeschreibung<br />
Das FFH-Gebiet Güsener Niederwald liegt mit<br />
e<strong>in</strong>er Flächengröße von 445 ha im Nordosten<br />
des Landes <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong> im Landkreis Jerichower<br />
Land, Geme<strong>in</strong>de Elbe-Parey. Landschaftlich<br />
wird das Gebiet dem Burger Vorfläm<strong>in</strong>g<br />
zugeordnet und bef<strong>in</strong>det sich am westlichen<br />
Rand im Übergangsbereich zum Elbtal. Im<br />
Untergrund s<strong>in</strong>d vor allem saaleglaziale Sande<br />
und Kiese zu f<strong>in</strong>den. Diesen aufgelagert s<strong>in</strong>d<br />
weichselkaltzeitliche Dünen.<br />
70<br />
Das Gebiet wird durch großflächige Laubwaldungen<br />
geprägt. Auf den tiefer gelegenen Bereichen<br />
stocken Erlenbruchwälder. Wasser steht <strong>in</strong> diesen<br />
nur noch an e<strong>in</strong>igen wenigen Stellen. Der<br />
Wasserstand ist stark abgesenkt. Reste e<strong>in</strong>er<br />
Hartholzaue mit Stieleiche, Geme<strong>in</strong>er Esche, Ulme<br />
und Ha<strong>in</strong>buche s<strong>in</strong>d ebenfalls zu f<strong>in</strong>den. Auf<br />
grundwasserferneren Standorten f<strong>in</strong>det man u. a.<br />
Kiefern, Rotbuchen und Birken. Der Waldanteil<br />
liegt bei etwa 400 ha. Umgeben ist das Gebiet <strong>in</strong><br />
der Hauptsache von Grünland.<br />
Ergebnisse<br />
Es wurden im Gebiet sieben Arten des Anhangs I<br />
der Vogelschutzrichtl<strong>in</strong>ie registriert. Weitere Arten<br />
der Roten Liste der Kategorien 1 und 2 wurden<br />
nicht gefunden. Im Standarddatenbogen s<strong>in</strong>d<br />
lediglich drei Anhang-I-Arten genannt, für die<br />
jeweils e<strong>in</strong>e Anzahl von 1-5 Brutpaaren angegeben<br />
ist. H<strong>in</strong>zugekommen s<strong>in</strong>d die vier Arten Wespenbussard,<br />
Kranich, Mittelspecht und Neuntöter.<br />
Gemessen am Anteil am Gesamtbestand <strong>in</strong> <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong><br />
(DORNBUSCH et al. 2007) hat das Untersuchungsgebiet<br />
e<strong>in</strong>e größere Bedeutung für<br />
Kranich (0,9 % des Landesbestandes) und Mittelspecht<br />
(0,8 %) (Tab. 2). Der Flächenanteil des<br />
FFH-Gebietes an der Gesamtfläche des Landes<br />
liegt bei 0,02 %.<br />
Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtl<strong>in</strong>ie<br />
Wespenbussard (Pernis apivorus): Der Wespenbussard<br />
siedelte mit e<strong>in</strong>em Brutpaar im Nordosten<br />
des Güsener Niederwaldes.<br />
Rotmilan (Milvus milvus): Es wurde e<strong>in</strong> Revier<br />
im Westen des Gebietes gefunden.<br />
Schwarzmilan (Milvus migrans): Es konnte e<strong>in</strong><br />
Revier im Westen des Untersuchungsgebietes<br />
kartiert werden.<br />
Kranich (Grus grus): Insgesamt wurden 2 Kranichreviere<br />
kartiert. E<strong>in</strong> Paar brütete im Südosten<br />
des Gebietes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Erlenbruch. Die erste Brut<br />
g<strong>in</strong>g verloren. Daraufh<strong>in</strong> brütete das Paar e<strong>in</strong> zweites<br />
Mal. E<strong>in</strong> Küken wurde gut vier Wochen alt.<br />
Anschließend wurde es nicht erneut beobachtet.<br />
Das zweite Paar brütete <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en ca. 1,5<br />
ha großen Schilfstück direkt an der Bahnl<strong>in</strong>ie im<br />
Nordwesten des Güsener Niederwaldes. Das Paar<br />
zog erfolgreich zwei Junge groß.<br />
Schwarzspecht (Dryocopus martius): Der<br />
Schwarzspecht hielt drei Reviere im Untersuchungsgebiet.<br />
E<strong>in</strong>e gefundene Bruthöhle befand<br />
sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Schwarzerle. Die kle<strong>in</strong>flächige Siedlungsdichte<br />
ist mit 0,67 Rev./km² sehr hoch (vgl.<br />
BAUER et al. 2005)<br />
Mittelspecht (Dendrocopos medius): Beim Mittelspecht<br />
konnten <strong>in</strong>sgesamt 21 Reviere nachgewiesen<br />
werden. Die Siedlungsdichte liegt somit