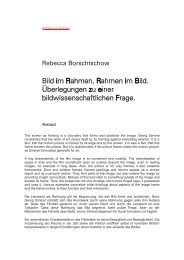EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN MAJETSCHAK UND WILLIAM J. THOMAS MITCHELLVergegenwärtigungsmedien ästhetischer Erfahrungen zu begreifen. Noch nicht einmal die Einsichtin die begriffliche Strukturiertheit der Wahrnehmung stellt eine unüberbrückbare Kluft zwischenAnalytikern und Phänomenologen dar, wieso sollte also die Einsicht in den Zeichencharakter einesBildes unvereinbar sein mit seiner ästhetischen Erfahrung?Überzeugend plädiert deshalb Günter Abel (Abel, Günter 2005: 13-29) da<strong>für</strong>, »die ganze Unterscheidungzwischen ›Zeichen und Phänomen‹ selbst aufzugeben« (22). Von repräsentationalistischenTheorien abgegrenzt, möchte Abel die <strong>Bildwissenschaft</strong> »in der Triangulation zwischen Zeichenphilosophie,Phänomenologie und Kunstgeschichte« verorten (20, Anm. 10). Dass Zeichen,ob Bilder oder nicht, erst praktisch vollzogen werden müssen, mache sie zu einer Angelegenheitder Interpretationsphilosophie, und die Interpretation beginne mit der Wahrnehmung. »OhneWahrnehmung gäbe es die Bilder ebenso wenig wie ohne Zeichen.« (17) Diese Vollzugsförmigkeitkann vermutlich gar nicht stark genug betont werden.Die Wahrnehmung rezipiert eben nicht nur Vorhandenes, sondern ergänzt und übersieht, selegiertund individuiert, weil sie von Einbildungs- und Vorstellungskraft durchsetzt ist. Man könntesagen, dass eine Pikturalität schon des Sehens und nicht erst des Zeigens jedes Bild zugleich zueinem Gegenstand der Imagination wie der Perzeption macht. Sehr zurecht betont daher Abelden Geschehenszusammenhang von Bild, Wahrnehmung und Interpretation und macht klar, dassBildtheorie nicht von Theorien der Wahrnehmung – und ergänzend müsste man hinzufügen: derEinbildungskraft – zu trennen ist. Bilder sind eben weniger Abbildungen von Gegenständen alsvielmehr Darstellungen von Sichtweisen. (Vgl. Schürmann, Eva 2005: 195–211) Die Sichtweisen,die Bilder konfigurieren, und die Sichtweisen, die die Betrachtenden darauf einnehmen, bilden einkonstellatives Gefüge, einen Geschehenszusammenhang von Gezeigtem und Gesehenen sowievon Wahrnehmung und Interpretation, der durch die repräsentationalistischen Konzeptes des Bildesals ›Bild-von‹ nicht erschlossen werden kann.Leider nur gestreift wird der Aspekt der Nicht-Propositionalität bildförmigen Wissens und Erfahrens,hier hätte man sich weitere Ausführungen gewünscht. Unter Nicht-Propositionalität darf nichtallein etwas verstanden werden, das nicht versprachlicht werden kann, und gleichwohl erkenntnisrelevantist, sondern mit dem Begriff taucht Bildhaftigkeit als ein Prinzip auf, das Vorstellungen,Romanen und anderen Zeichenträgern gleichermaßen zukommen kann. Wie das im Einzelnen zuverstehen ist, wäre eingehender zu prüfen.Hans Belting (Belting, Hans 2005: 31-47) zieht die Kontroverse Bild versus Zeichen als Streit umdie Alternative zwischen Präsenz und Repräsentation auf. Seine historische Rekonstruktion derGeschichte des Ikonoklasmus am Beispiel des Kruzifix macht Unterschiede zwischen Bildern undZeichen am Körper fest. Als plastische Darstellung des Körpers Christi gilt das Kruzifix den Ikonodulenals Kultbild, während <strong>für</strong> Ikonoklasten nur das leere Kreuz als substituierendes, verweisendesZeichen <strong>für</strong> Christus akzeptabel ist. Dass dieser Dissens nicht auf Byzanz und Westrom zubegrenzen ist, zeigt die hierzulande noch vor wenig mehr als einem Jahrzehnt geführte Debatte,ob man den Gekreuzigten eigentlich in den Klassenzimmern repräsentiert sehen will. Die inkorporierendeKraft des Bildes macht es Belting zufolge über seine stellvertretende Zeichenhaftigkeithinaus bedrohlich. Auch im Kult um Kreuzesreliquien sieht er seine Körperthese bestätigt: Die Referenzder Bilder sei immer schon der Körper, eine »Autoreferenz, die nicht das Bild auf sich selbst,IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 118
EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN MAJETSCHAK UND WILLIAM J. THOMAS MITCHELLsondern auf lebende Körper bezieht, deren Absenz sich in eine andere Präsenz, die Präsenz desBildes verwandelt.« (31)Zwar könnte man einwenden, dass der Körper Christi seinerseits ein Symbol <strong>für</strong> das Leiden Gottesist. Doch wird das Argument dadurch nicht insgesamt hinfällig. Das in-effigie-esse des gekreuzigtenGottes macht einen entscheidenden Unterschied zu allen verweisenden Substituten aus.Das theologische Transsubstantiationsproblem der Frage danach, was in der Eucharistie anwesendsei, wiederholt sich Belting zufolge gleichsam auf semiotischer Ebene in der Entscheidung,Gott körperlich zu vergegenwärtigen oder lieber stellvertretend zu repräsentieren. »Bilder teilenMerkmale von Körpern wie Bewegung und Blick.« (32) Zeichen hingegen könnten nicht auf unszurückblicken, weswegen man sie auch nicht verehre.Wenn Belting so von Bildern spricht, dann meint er jedoch nicht dasselbe, was Wolfgang Nöth imSinn hat, wenn er die These, dass Bilder Zeichen sind, erwartungsgemäß verteidigt. Interessanterjedoch als solche terminologischen Differenzen ist Beltings Durchführung, zeigt sie doch, dass dieFrage nach dem Bild kulturwissenschaftlich ausgeweitet werden kann, ohne dass dabei das Besonderedes Kunstbildes aus dem Blick geraten muss oder Gattungs- und Qualitätsunterschiedezwischen ihm und seinen familienähnlichen Anverwandten eingeebnet werden.Klaus Sachs Hombachs (Sachs-Hombach, Klaus 2005: 157-177) Verdienste um die Etablierungeiner eigenständigen <strong>Bildwissenschaft</strong> belegen seit Jahren zahlreiche Publikationen, in denen erVertreter verschiedener Disziplinen zusammenbringt, um das Feld der <strong>Bildwissenschaft</strong> systematischund methodisch abzustecken und auszuloten. Dazu gehört auch der Aufbau eines Zentrums<strong>für</strong> <strong>interdisziplinäre</strong> Bildforschung (ZIB), unter dessen Dach neben Grundlagendisziplinen derKunstwissenschaft und Philosophie, auch Computervisualistik, Psychologie oder Kognitionswissenschaftenversammelt sind.In Majetschaks Band unterbreitet Klaus Sachs-Hombach den <strong>für</strong> eine gesellschaftspolitischeRechtfertigung der <strong>Bildwissenschaft</strong>en bedeutsamen Vorschlag, »ein Schulfach einzurichten, welches›Bildmedienerziehung‹ heißen könnte und das den spezifisch <strong>interdisziplinäre</strong>n Anforderungenan die Bildthematik gerecht wird.« (163) Ein solches Fach zum Zwecke einer Art Mündigkeitim Umgang mit Bildern könnte wirklich geeignet sein, die Bildforschung gesellschaftlich zu legitimieren.Leitend ist dabei die Annahme, dass der Umgang mit Bildern eine wichtige Kulturtechnikdarstellt, die kritisch erworben und ausgebildet werden muss, gerade angesichts neuerer technischerBildherstellungsverfahren, die einer Manipulation und Herstellung von Sichtbarkeit vielnäher stehen als einer Abbildung. Fortgeschrittene Möglichkeiten der technische Bildproduktionund Bilddistribution im Netz – das haben die visuelle Berichterstattung im Irak-Krieg oder die mitdem Handy aufgenommenen Obszönitäten aus Abu Ghraib gezeigt – lassen den kritischen Umgangmit Bildern zu einem wesentlichen Aspekt des politisch-gesellschaftlichen Leben werden.Angesichts des aufdringlichen Bildgebrauchs der Medien ist die Ausbildung einer kritischen Bildkompetenz1 unverzichtbar, um die Strategien manipulativen Bildeinsatzes kritisch durchschauenzu können, anstatt wehrlos davon affiziert zu werden. Eine Bildkompetenz, die sich gegen affek-1 Zu dieser Idee einer Bildkompetenzerziehung in der Schule vgl. auch das Sonderheft der Netzzeitschrift <strong>Image</strong>, von EvaSchäfer besorgt: http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal/IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 119
- Seite 1 und 2:
IMAGE - Zeitschrift für interdiszi
- Seite 3 und 4:
[Inhaltsverzeichnis]Beatrice Nunold
- Seite 5:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 9 und 10:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 11 und 12:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 13 und 14:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 15:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 21 und 22:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 23 und 24:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 25 und 26:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 27 und 28:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 29 und 30:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 31 und 32:
BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOP
- Seite 33 und 34:
[Inhaltsverzeichnis]Stephan Günzel
- Seite 35 und 36:
STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE A
- Seite 37 und 38:
STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE A
- Seite 39 und 40:
STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE A
- Seite 41 und 42:
STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE A
- Seite 43 und 44:
STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE A
- Seite 45 und 46:
STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE A
- Seite 47 und 48:
[Inhaltsverzeichnis]Mario Borillo/J
- Seite 49 und 50:
MARIO BORILLO/JEAN-PIERRE GOULETTE:
- Seite 51 und 52:
MARIO BORILLO/JEAN-PIERRE GOULETTE:
- Seite 53 und 54:
MARIO BORILLO/JEAN-PIERRE GOULETTE:
- Seite 55 und 56:
MARIO BORILLO/JEAN-PIERRE GOULETTE:
- Seite 57 und 58:
MARIO BORILLO/JEAN-PIERRE GOULETTE:
- Seite 59 und 60:
ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELT
- Seite 61 und 62:
ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELT
- Seite 63 und 64:
ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELT
- Seite 65 und 66:
ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELT
- Seite 67 und 68: ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELT
- Seite 69 und 70: ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELT
- Seite 71 und 72: [Inhaltsverzeichnis]Elize BisanzZum
- Seite 73 und 74: ELIZE BISANZ: ZUM ERKENNTNISPOTENZI
- Seite 75 und 76: ELIZE BISANZ: ZUM ERKENNTNISPOTENZI
- Seite 77 und 78: ELIZE BISANZ: ZUM ERKENNTNISPOTENZI
- Seite 79 und 80: IMAGE - Zeitschrift für interdiszi
- Seite 81 und 82: FRANZ REITINGER: KARIKATURENSTREITm
- Seite 83 und 84: FRANZ REITINGER: KARIKATURENSTREITv
- Seite 85 und 86: FRANZ REITINGER: KARIKATURENSTREITM
- Seite 87 und 88: FRANZ REITINGER, REZENSION: GESCHIC
- Seite 89 und 90: [Inhaltsverzeichnis]Franz Reitinger
- Seite 91 und 92: FRANZ REITINGER, REZENSION: SUSANNE
- Seite 93 und 94: FRANZ REITINGER, REZENSION: SUSANNE
- Seite 95 und 96: [Inhaltsverzeichnis]Franz Reitinger
- Seite 97 und 98: FRANZ REITINGER, REZENSION: SIGRUN
- Seite 99 und 100: [Inhaltsverzeichnis]Klaus Sachs-Hom
- Seite 101 und 102: KLAUS SACHS-HOMBACH, REZENSION: BEN
- Seite 103 und 104: SASCHA DEMARMELS, REZENSION: WOLFGA
- Seite 105 und 106: [Inhaltsverzeichnis]Sascha Demarmel
- Seite 107 und 108: SASCHA DEMARMELS, REZENSION: KLAUS
- Seite 109 und 110: THOMAS MEDER, REZENSION: UWE STOKLO
- Seite 111 und 112: THOMAS MEDER, REZENSION: KLAUS SACH
- Seite 113 und 114: [Inhaltsverzeichnis]Eva Schürmann
- Seite 115 und 116: EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN M
- Seite 117: EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN M
- Seite 121 und 122: EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN M
- Seite 123 und 124: EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN M
- Seite 125 und 126: EVA SCHÜRMANN, REZENSION: STEFAN M
- Seite 127 und 128: [Inhaltsverzeichnis]ImpressumIMAGE









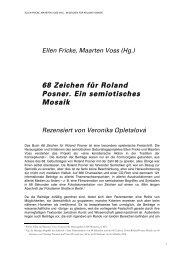

![image 11 [pdf] - Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft](https://img.yumpu.com/41525154/1/184x260/image-11-pdf-gesellschaft-fur-interdisziplinare-bildwissenschaft.jpg?quality=85)