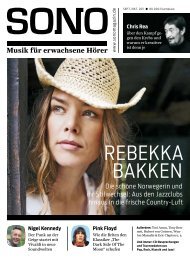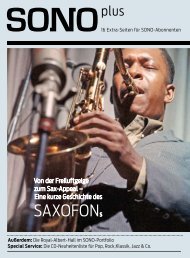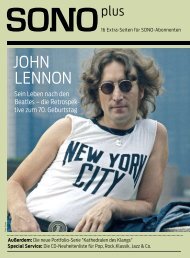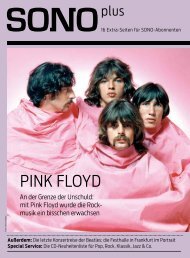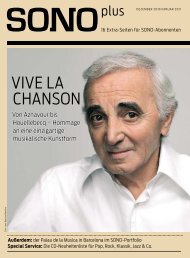Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fotos: Haags Uitbüro, Vereinte Nationen<br />
Pop und Politik – sie scheinen in Südafrikas<br />
Popmusik untrennbar miteinander verknüpft.<br />
Und Makeba symbolisierte das wie<br />
niemand zuvor: Buhlten doch linke Musikerkollegen<br />
wie auch afrikanische Staatschefs<br />
um ihre Gunst, lud sie Präsident Kennedy zu<br />
seiner Geburtstags-Party ein, verlieh ihr gar<br />
Commandante Fidel Castro persönlich die kubanische<br />
Ehrenbürgerschaft.<br />
Dabei sah sich Makeba selbst eher als<br />
Griot* denn Politikerin: „Vielleicht denkt die<br />
Welt “, erklärte sie, „ich hätte es mir ausgesucht,<br />
über die Zustände in Südafrika zu berichten.<br />
Nein! Ich singe nur über mein Leben,<br />
so wie wir daheim von jeher über unser Leben<br />
* So nennt man im westafrikanischen Raum<br />
singende Geschichtenerzähler<br />
Hugh Masekela als junger Jazzhipster in den<br />
USA (o.) und in reiferen Jahren beim Besuch<br />
einer heimischen Township (o.li.)<br />
Miriam Makeba, das singende Nationalheiligtum,<br />
kurz vor ihrem Tod 2008 (o.) und bei<br />
ihrem Auftritt vor der UNO 1963<br />
singen – besonders die Dinge, die uns verletzen“.<br />
Hinter meist optimistischen Melodien<br />
versteckten sich in der Regel widerständige<br />
Botschaften. Und unter den Tanzrhythmen<br />
blitzte die Subversion: „Südafrikas Musik“,<br />
hatte Makebas erster Ehemann, der Jazz-<br />
Trompeter Hugh Masekela in dieselbe Kerbe<br />
geschlagen, „handelt immer von Gerechtigkeit,<br />
menschlicher Würde und dem Aufbegehren<br />
gegen die Fremdbeherrschung. Selbst Liebeslieder<br />
machen da keine Ausnahme: Come back<br />
from Johannesburg my dear, where you have to<br />
work …“ Wie Makeba hatte auch Masekela im<br />
nordamerikanischen Exil den Schmerz und<br />
die Sehnsucht der heimischen Townships in<br />
poppige Melodien gefasst. „Coal Train“ hießen<br />
sie. Oder „Happy Mama“. Und handelten<br />
nicht selten von Gefangenen, Bergleuten und<br />
Wanderarbeitern.<br />
„Ich singe nur über mein<br />
Leben, so wie wir<br />
daheim von jeher über<br />
unser Leben singen –<br />
besonders die Dinge, die<br />
uns verletzen“ Miriam Makeba<br />
Impulse aus Nordamerika<br />
Schon seit den 30er Jahren hatten die schwarzen<br />
Südafrikaner die Pop-Moden Amerikas<br />
aufgesaugt: Den Ragtime, den Jazz und später<br />
den Rhythm’n’Blues. Doch erst durch den<br />
Flüchtlingsstrom von Musikern aus Kapstadt<br />
und Johannesburg in Richtung New York und<br />
Los Angeles kam es zu einem wirklichen Austausch.<br />
Nicht zuletzt weil sich die Musiker in<br />
der erzwungenen Fremde auf ihre heimatlichen<br />
Traditionen besannen: So hatte etwa<br />
Hugh Masekela lange amerikanischen Jazz<br />
gespielt – weil es für südafrikanische Musik<br />
vor Miriam Makeba keinen Markt gab. Deren<br />
frühe Hits wie „Malaika“ , „The Click Song“<br />
oder eben „Pata Pata“ bereiteten auch seinen<br />
Durchbruch vor: „Miles Davis nahm mich<br />
damals zur Seite“, erzählt Masekela. „Warum,<br />
fragte er mich, willst du unbedingt wie<br />
»<br />
19