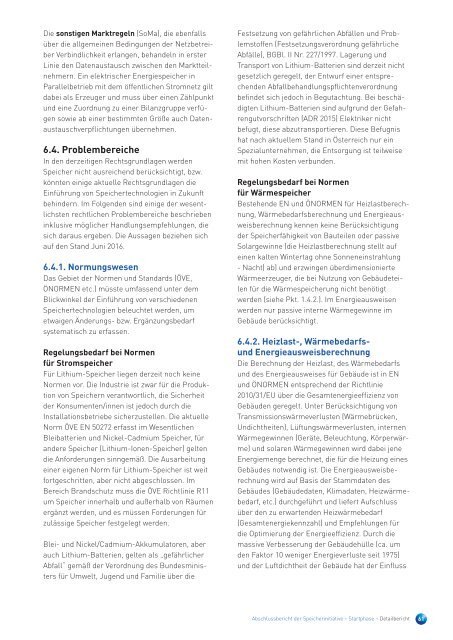Speicherinitiative – Bericht Phase1
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die sonstigen Marktregeln (SoMa), die ebenfalls<br />
über die allgemeinen Bedingungen der Netzbetreiber<br />
Verbindlichkeit erlangen, behandeln in erster<br />
Linie den Datenaustausch zwischen den Marktteilnehmern.<br />
Ein elektrischer Energiespeicher in<br />
Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Stromnetz gilt<br />
dabei als Erzeuger und muss über einen Zählpunkt<br />
und eine Zuordnung zu einer Bilanzgruppe verfügen<br />
sowie ab einer bestimmten Größe auch Datenaustauschverpflichtungen<br />
übernehmen.<br />
6.4. Problembereiche<br />
In den derzeitigen Rechtsgrundlagen werden<br />
Speicher nicht ausreichend berücksichtigt, bzw.<br />
könnten einige aktuelle Rechtsgrundlagen die<br />
Einführung von Speichertechnologien in Zukunft<br />
behindern. Im Folgenden sind einige der wesentlichsten<br />
rechtlichen Problembereiche beschrieben<br />
inklusive möglicher Handlungsempfehlungen, die<br />
sich daraus ergeben. Die Aussagen beziehen sich<br />
auf den Stand Juni 2016.<br />
6.4.1. Normungswesen<br />
Das Gebiet der Normen und Standards (ÖVE,<br />
ÖNORMEN etc.) müsste umfassend unter dem<br />
Blickwinkel der Einführung von verschiedenen<br />
Speichertechnologien beleuchtet werden, um<br />
etwaigen Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf<br />
systematisch zu erfassen.<br />
Regelungsbedarf bei Normen<br />
für Stromspeicher<br />
Für Lithium-Speicher liegen derzeit noch keine<br />
Normen vor. Die Industrie ist zwar für die Produktion<br />
von Speichern verantwortlich, die Sicherheit<br />
der Konsumenten/innen ist jedoch durch die<br />
Installationsbetriebe sicherzustellen. Die aktuelle<br />
Norm ÖVE EN 50272 erfasst im Wesentlichen<br />
Bleibatterien und Nickel-Cadmium Speicher, für<br />
andere Speicher (Lithium-Ionen-Speicher) gelten<br />
die Anforderungen sinngemäß. Die Ausarbeitung<br />
einer eigenen Norm für Lithium-Speicher ist weit<br />
fortgeschritten, aber nicht abgeschlossen. Im<br />
Bereich Brandschutz muss die ÖVE Richtlinie R11<br />
um Speicher innerhalb und außerhalb von Räumen<br />
ergänzt werden, und es müssen Forderungen für<br />
zulässige Speicher festgelegt werden.<br />
Blei- und Nickel/Cadmium-Akkumulatoren, aber<br />
auch Lithium-Batterien, gelten als „gefährlicher<br />
Abfall“ gemäß der Verordnung des Bundesministers<br />
für Umwelt, Jugend und Familie über die<br />
Festsetzung von gefährlichen Abfällen und Problemstoffen<br />
(Festsetzungsverordnung gefährliche<br />
Abfälle), BGBl. II Nr. 227/1997. Lagerung und<br />
Transport von Lithium-Batterien sind derzeit nicht<br />
gesetzlich geregelt, der Entwurf einer entsprechenden<br />
Abfallbehandlungspflichtenverordnung<br />
befindet sich jedoch in Begutachtung. Bei beschädigten<br />
Lithium-Batterien sind aufgrund der Gefahrengutvorschriften<br />
(ADR 2015) Elektriker nicht<br />
befugt, diese abzutransportieren. Diese Befugnis<br />
hat nach aktuellem Stand in Österreich nur ein<br />
Spezialunternehmen, die Entsorgung ist teilweise<br />
mit hohen Kosten verbunden.<br />
Regelungsbedarf bei Normen<br />
für Wärmespeicher<br />
Bestehende EN und ÖNORMEN für Heizlastberechnung,<br />
Wärmebedarfsberechnung und Energieausweisberechnung<br />
kennen keine Berücksichtigung<br />
der Speicherfähigkeit von Bauteilen oder passive<br />
Solargewinne (die Heizlastberechnung stellt auf<br />
einen kalten Wintertag ohne Sonneneinstrahlung<br />
- Nacht) ab) und erzwingen überdimensionierte<br />
Wärmeerzeuger, die bei Nutzung von Gebäudeteilen<br />
für die Wärmespeicherung nicht benötigt<br />
werden (siehe Pkt. 1.4.2.). Im Energieausweisen<br />
werden nur passive interne Wärmegewinne im<br />
Gebäude berücksichtigt.<br />
6.4.2. Heizlast-, Wärmebedarfsund<br />
Energieausweisberechnung<br />
Die Berechnung der Heizlast, des Wärmebedarfs<br />
und des Energieausweises für Gebäude ist in EN<br />
und ÖNORMEN entsprechend der Richtlinie<br />
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von<br />
Gebäuden geregelt. Unter Berücksichtigung von<br />
Transmissionswärmeverlusten (Wärmebrücken,<br />
Undichtheiten), Lüftungswärmeverlusten, internen<br />
Wärmegewinnen (Geräte, Beleuchtung, Körperwärme)<br />
und solaren Wärmegewinnen wird dabei jene<br />
Energiemenge berechnet, die für die Heizung eines<br />
Gebäudes notwendig ist. Die Energieausweisberechnung<br />
wird auf Basis der Stammdaten des<br />
Gebäudes (Gebäudedaten, Klimadaten, Heizwärmebedarf,<br />
etc.) durchgeführt und liefert Aufschluss<br />
über den zu erwartenden Heizwärmebedarf<br />
(Gesamtenergiekennzahl) und Empfehlungen für<br />
die Optimierung der Energieeffizienz. Durch die<br />
massive Verbesserung der Gebäudehülle (ca. um<br />
den Faktor 10 weniger Energieverluste seit 1975)<br />
und der Luftdichtheit der Gebäude hat der Einfluss<br />
Abschlussbericht der <strong>Speicherinitiative</strong> <strong>–</strong> Startphase <strong>–</strong> Detailbericht<br />
61