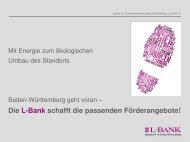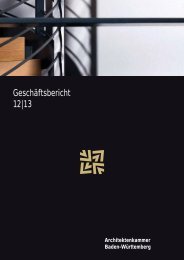Fortbildungsplaner 22012 - Architektenkammer Baden-Württemberg
Fortbildungsplaner 22012 - Architektenkammer Baden-Württemberg
Fortbildungsplaner 22012 - Architektenkammer Baden-Württemberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
38<br />
Die AKBW appelliert an den Gesetzgeber, nicht einseitig Einzelmaßnahmen der<br />
ökologischen Modernisierung Vorrang zu geben. Zwar mag eine Regelung zur nachträglichen<br />
Ausweitung des legalen Überbaus auf nachträgliche Maßnahmen zur<br />
Energieeinsparung bei bestehenden Grenzgebäuden im Einzelfall hilfreich sein. Es<br />
gilt jedoch, bei einer ökologischen Modernisierung von Rechts- und Planungsvorschriften<br />
eine Grundlage zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu schaffen.<br />
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die ganzheitliche und ausgewogene Betrachtung des<br />
Klimawandels. Vorgaben, die eine einseitige Nutzung regenerativer Energien fördern,<br />
darf nicht Vorrang gegenüber anderen Möglichkeiten gewährt werden.<br />
In der Anregung zum geplanten „Sanierungsfahrplan“– und im Vorgriff auf die anstehende<br />
Novellierung des E-Wärme-Gesetzes des Landes – wird die Haltung der Kammer<br />
deutlich: „Für eine nachhaltige und zielführende energetische Sanierung des<br />
Gebäudebestandes ist zunächst eine fundierte und ganzheitliche Untersuchung und<br />
Bewertung des vorhandenen Zustandes dringend angeraten, um gegebenenfalls zuerst<br />
die bauliche Hülle zu optimieren und erst dann die Anlagentechnik auf den so reduzierten<br />
Energiebedarf auszulegen. Dadurch wird vermieden, gerade bei Austausch<br />
bzw. Anlagenersatz in eine letztlich zu große, unwirtschaftliche und energetisch<br />
ineffiziente Heizungsanlage zu investieren. Gerade um dem Ziel der Energieeinsparung<br />
und CO 2 -Minderung tatsächlich gerecht zu werden, liegt es ja auch im Interesse<br />
des Umweltministeriums, eher bei einer Gebäudesanierung den Energiebedarf insgesamt<br />
um 90 Prozent zu senken („Faktor-10-Sanierung“), als einen unnötig hohen<br />
Verbrauch zu 10 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken.“<br />
Beratungsdienst: Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Sicherheit,<br />
wirtschaftliche Bauplanung und -durchführung und vieles andere mehr<br />
Was zählt in einem Bebauungsplan von 1968 als Vollgeschoss? Wann ist ein Dach<br />
ein Satteldach? Wie ist der Grenzabstand von Dachgauben zu bemessen? Wo darf<br />
ein Spiel- und Kletterturm bei einem Einfamilienhaus platziert werden? Welche Balkongeländer<br />
dürfen im Wohnungsbau ausgeführt werden und wann braucht eine<br />
Glasbrüstung eine Zulassung im Einzelfall, weil sie von der „TRAV“ Technische<br />
Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen abweicht? Welche<br />
Änderungen brachte die Gebäudeklassifikation der LBO 2010 und was sind die<br />
Auswirkungen beim Brandschutz? Was ist erforderlich, um in einer Brandwand eine<br />
Lichtöffnung zu ermöglichen? Berechnung von Wohnflächen nach DIN 277 oder<br />
Wohnflächenverordnung? Was tun bei Schimmel, Asbest oder PCB? Wie sieht eine<br />
barrierefreie Gebäudeerschließung aus?<br />
Bei einer Vielzahl unterschiedlichster Fragen stand den Kammermitgliedern auch<br />
im vergangenen Jahr der Beratungsdienst der AKBW zur Verfügung. Aber nicht nur<br />
Anfragen zu den planerischen Anforderungen des Baurechts mit Landesbauordnung<br />
und zugehöriger Ausführungsverordnung gehören zum Alltag. Die Verkehrssicherheit<br />
baulicher Anlagen allgemein sowie Sicherheit und Arbeitsschutz auf der Grundlage<br />
des Arbeitsschutzrechts tangieren die Arbeit von Planern ebenfalls. So besteht<br />
beispielsweise bei Schulbauten und Einrichtungen für Kinder großer Beratungsbedarf<br />
hinsichtlich der Regelungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.<br />
Allgemein hat das neu gestaltete Arbeitsstättenrecht mit den sukzessiv neu veröffentlichten<br />
Regeln für Arbeitsstätten ASR als nur „beispielhafte Konkretisierungen<br />
mit Vermutungswirkung“ die Arbeitsstättenplanung eher verkompliziert. Ohne die<br />
Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers kann der Architekt letztlich nur auf allgemeine<br />
Erfahrungswerte zurückgreifen, ohne Gewähr, dass das geplante Bauvorhaben<br />
dann im konkreten Anwendungsfall nicht doch auf die spezifischen Belange der jeweils<br />
Beschäftigten nachzurüsten ist.