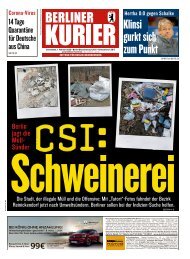Berliner Zeitung 28.11.2018
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22 * <strong>Berliner</strong> <strong>Zeitung</strong> · N ummer 278 · M ittwoch, 2 8. November 2018<br />
·························································································································································································································································································<br />
Feuilleton<br />
Ein Ort<br />
der<br />
Freiheit<br />
Das Gefangenentheater<br />
Aufbruch spielt „Hamlet“<br />
Jeder<br />
trägt sein<br />
Kreuzchen<br />
Die Potsdamer Winteroper<br />
zeigt Händels „Theodora“<br />
VonJanis El-Bira<br />
Selbst Schloss Kronborg dürfte<br />
kaum besser bewacht gewesen<br />
sein. Im Herzen des grimmigen <strong>Berliner</strong><br />
Gefängnisviertels entlang des<br />
Friedrich-Olbricht-Damms wartet<br />
man zunächst lange voreiner meterhohen<br />
Stahlpforte, bis diese sich irgendwann<br />
wie von Geisterhand einen<br />
Spalt weit öffnet, um Einlass in<br />
die Jugendstrafanstalt zu gewähren.<br />
Im ersten Hofwerden sämtliche mitgeführten<br />
Gegenstände unter freiem<br />
Himmel an kotzgrüne Schließfächer<br />
überantwortet, Personal- gegen Besucherausweise<br />
getauscht. Funktionsräume<br />
der vollständigen Kontrolle<br />
sind das, wie sie das Theater<br />
zurzeit gern imRahmen immersiver<br />
Erfahrungswelten verkauft. Aber das<br />
hier ist kein Spiel. Gespielt wird erst<br />
hinter zwei weiteren Türen. Dort, im<br />
Veranstaltungsraum der JVA, ist es<br />
warm und gutgläubig wie in einer<br />
Schulaula. Nur ein Banner mit der<br />
fies-freundlichen Losung „Jugend<br />
braucht Zukunft –wir feilen daran“<br />
erinnertandie vergitterten Fenster.<br />
So viel Talent<br />
Gefeilt wird andiesem Abend mithilfe<br />
vonShakespeares „Hamlet“, jenem<br />
Stück also, das auf vielfältige<br />
Weisen Gefangenschaft thematisiert<br />
– vor allem solche, die nicht von<br />
Stein und Ketten, sondernvom eigenen<br />
Kopf ausgeht. Kondensierte 70<br />
Minuten lang spielen junge Männer<br />
im Alter von 17bis 27 Jahren, deren<br />
Namen im Programmheft zumeist<br />
nicht ihre echten sind, auf zwei beweglichen<br />
Treppen. Es ist der erste<br />
Shakespeare inder zwanzigjährigen<br />
Geschichte des <strong>Berliner</strong> Gefangenentheaters<br />
Aufbruch und so viel Talent<br />
ist dabei zu erleben, dass man<br />
meint, einige dieser Jungs gehörten<br />
eigentlich unbedingt auf die Nachwuchsspielstätten<br />
des Gorki-Theaters<br />
oder der Volksbühne.<br />
Ein sagenhaft viriler Laertes verkörpert<br />
muckibuden-gestählte Bruderehre,<br />
König Claudius ist ein Hinterzimmer-Pate<br />
mit Halskrause und<br />
Rauschebart und ein gewichtiger<br />
Kollege zwängt seinen Körper mit erkennbarem<br />
Spaß in Königin Gertrudes<br />
üppigen Reifrock. Zwischen ihnen<br />
und der porzellanenen Ophelia<br />
irrtund zaudertHamlet, die Last der<br />
übergroßen Rolle gleich auf mehrere<br />
Spielerschultern verteilt. Mühelos<br />
füllen diese Stimmen den Raum.<br />
Die inüber sieben Wochen Probenzeit<br />
erarbeiteten Texte kommen<br />
ohne jeden Fehltritt. Ein bisschen<br />
wünscht man sich, der Regisseur Peter<br />
Atanassowhätte etwas mehr Freiheiten<br />
zugelassen und einige panzerharte<br />
Müller- und Koltès-Einsprengsel<br />
zugunsten eigener Gedanken<br />
der Häftlinge eingedampft. Aber<br />
vielleicht ist das Selbstverständnis<br />
seines Ensembles an diesem Abend<br />
ja auch schlicht das einer Schauspielertruppe<br />
–nicht das performender<br />
Insassen. So oder so: Diese Gefängnisbühne<br />
ist ein Ortder Freiheit, der<br />
seine Zuschauer nur widerwillig<br />
durch verriegelte Türen nach draußen,<br />
in die Kälte,entlässt.<br />
Hamlet 28., 30.11.; 3., 5., 7.12., um 17.30Uhr,<br />
JSA Berlin (Kultursaal), Friedrich-Olbricht-Damm<br />
40/III, Karten:gefaengnistheater.de<br />
„Hamlet“ −der erste Shakespeare in<br />
20 Jahren Aufbruch-Theater THOMAS AURIN<br />
Hans Ticha, Berlin (Ost) 1981: „Redner“. Symbolik für die unechte deutsch-sowjetische Freundschaft. GAL.LÄKEMÄKER/H. TICHA/VG BILDKUNST BONN/ U. FISCHER<br />
Maikäfer flieg<br />
In Frankfurt (Oder) ist deutsche Malerei zwischen Agit Pop und kapitalistischem Realismus zu sehen<br />
VonIngeborg Ruthe<br />
Außen backsteinerne Neo-<br />
Gotik, innen Pop-Moderne:<br />
Unterm Gewölbe<br />
kommt farbknallend zusammen,<br />
was −erstaunlicherweise −<br />
zusammengehört, mit Blick auf die<br />
gesellschaftlichen und politischen<br />
Verhältnisse im geteilten Deutschland,<br />
damals,imKalten Krieg.<br />
In der weitläufigen Rathaushalle<br />
von Frankfurt (Oder), Ausstellungsort<br />
des Brandenburgischen Landesmuseums<br />
für moderne Kunst, wird<br />
ein hartnäckiges Vorurteil ad absurdum<br />
geführt: Eine spezielle Kunstrichtung<br />
im Osten wie im Westen –<br />
die PopArt deutscher Prägung in den<br />
Jahren 1960 bis 1985 –bestätigt so<br />
gar nicht die zäh behaupteten Unterschiede<br />
etwa vonder freien Kunst im<br />
Westen und der doktrinären, angepassten<br />
in der DDR.<br />
Was bitte wäre sozialistisch-realistisch<br />
an Hans Tichas plakativ-böser<br />
Kritik an den heuchlerischen Reden<br />
von der verordneten deutschsowjetischen<br />
Freundschaft? Was<br />
wäre linientreu an Willy Wolfs „Erbsenstillleben“<br />
im kleinen Erbsenzählerland<br />
von Kap Arkona bis Fichtelberg?<br />
Und was ideologisch angepasst<br />
anWasja Götzes feinironischen<br />
Bildern von der Liebe im Dreischichtsystem<br />
der volkseigenen<br />
Kombinate, von den roten Vögeln,<br />
die der ummauerten Landschaft<br />
entfliehen? Warummusste Ticha damals<br />
in Ost-Berlin seine „Großen<br />
Klatscher“, diese beißende Satireauf<br />
die Jubel-Parteitage der Einheitspartei,<br />
vorder Stasi verstecken?<br />
Solche Bilder sah das Publikum<br />
nie auf zentralen Ausstellungen der<br />
DDR. Diemussten ihreMaler bei diversen<br />
Besuchen der Kunstaufpasser<br />
eher „mit der Butterseite“ zur Wand<br />
stellen, wie Ticha es schildert. Sonst<br />
hätte es Ärger gegeben, auch übel<br />
ausgehen können, existenziell sogar.<br />
Doch die damaligen bezirklichen<br />
Kunstsammlungen Cottbus und<br />
Frankfurt (Oder) unterliefen die Inquisition<br />
und deren mutige Direktionen<br />
sammelten diese Bilder. Samt<br />
etlicher Leihgaben aus anderen Museen<br />
und Privatsammlungen befinden<br />
sich nun viele der Motiveindieser<br />
Ausstellung im intensiven Dialog<br />
mit den gesellschaftskritischen Bildern<br />
der Gruppe „Kapitalistischer<br />
Realismus“ in der BRD. Der Begriff<br />
wurde 1963 an der Kunstakademie<br />
Düsseldorf von den aus dem Osten<br />
geflohenen jungen Malern Gerhard<br />
„…der Vater ist im Krieg“ –gemalt von Bettina von Arnim 1974 in West-Berlin zur<br />
Hochrüstung zwischen den politischen Systemen. BETTINA VON ARNIM/PPC FRANKFURT A.MAIN/W.GÜNZEL<br />
„Rote Vögel entfliegen“ malte Wasja Götze in Halle 1970<br />
REAL POP 1960-1985 AUF BEIDEN SEITEN DER MAUER<br />
Deutsche PopArt: Knallige<br />
Farben, Plakatives, Sarkasmus<br />
kennzeichnen die Bilder<br />
der „Pop-Artisten“ aus dem<br />
deutschenOsten wie Westen<br />
der 1960er- bis80er- Jahre.<br />
Die Künstler: Aufbeiden<br />
Seiten der Mauer übten sie<br />
Gesellschaftskritik zu Politik<br />
und Alltag.Inder DDR hatte<br />
diese Haltung oft auch existenzielle<br />
Folgen.<br />
BLMK/WASJA GÖTZE<br />
Die Ausstellung: Das Landesmuseum<br />
zeigt in der Rathaushalle<br />
Frankfurt(Oder)<br />
„Real Pop1960–1985“,<br />
bis 17. Februar,Marktplatz1,<br />
Di–So 11–17 Uhr.<br />
Richter,Sigmar Polke,Manfred Kuttner<br />
und dem Rheinländer Konrad<br />
Lueg eingeführt. Die„bessereGesellschaft“,<br />
allen voran die Anbeter der<br />
abstrakten Kunst fanden die figürlich<br />
und gegenständlich malenden<br />
Kunstverstörer infernalisch, das gehöreverboten.<br />
Luegs „Geschirrtuch“<br />
symbolisierte die Kleinkariertheit<br />
der Wohlstandsgesellschaft. Polkes<br />
Grafik „HöhereWesen befehlen“ lästert<br />
über die Abhängigkeit von<br />
Trends und Markt. Und Richters fotomalerisch<br />
verhuschte „Sekretärin“<br />
zielt scharf auf das patriarchalische<br />
Prinzip,dass damals in der BRD verheiratete<br />
Frauen nur mit Erlaubnis<br />
der Ehemänner arbeiten durften.<br />
Die „Kapitalistischen Realisten“<br />
provozierten mit Selbsthilfe-Ausstellungen<br />
und Aktionen als ironischer<br />
Konter zum Sozialistischen Realismus,aber<br />
auch als politisch aufgeladene<br />
Kritik an dem vonder Konsumwelle<br />
und dem Freizeitwahn geprägten<br />
„realen“ Kapitalismus der 1960er<br />
Jahre, dem aufkommenden Revanchismus<br />
und Konservatismus, der<br />
Aufrüstung, dem oft verlogenen Umgang<br />
mit der NS-Geschichte.<br />
In der Frankfurter Rathaushalle<br />
hängen die 150 Bilder von 30Künstlern<br />
ohne ideologische Abgrenzung<br />
nebeneinander. Geistverwandte:<br />
Konrad Klapphecks surreal-poppige<br />
„Diva“ nahe Dieter Tucholkes grafischen<br />
„Negativbildern zur Preußischen<br />
Geschichte“. Die ostdeutschen<br />
Collagisten Ingo Kirchner und<br />
Wolfgang Petrovsky treffen auf die<br />
„Bürgerschreck“-Montagen des aus<br />
Bitterfeld nach Heidelberg emigrierten<br />
Klaus Staeck. Wolf Vostells „B52<br />
betoniert“ vereint sich west-östlich<br />
mit Willy Wolfs „Warnung (Autoreifen)“.<br />
Und Ruth Wolf-Rehfeldts<br />
abstrakte Liniengebilde und die Entgrenzung<br />
einfordernden Mail-Art-<br />
Blätter ihres früh gestorbenen Mannes<br />
RobertRehfeldt stören –sozusagen<br />
als Rufe hinter der Mauer –den<br />
bundesdeutschen Wirtschaftswunder-Wohlstand,<br />
kitschig spöttisch<br />
aufgemalt von der Hamburgerin Almut<br />
Heise.<br />
Nicht zuletzt schließt sich Bettina<br />
von Arnims Bild „…der Vater ist im<br />
Krieg“ wortlos kurzmit dem Bild des<br />
jung verstorbenen Dissidenten Jürgen<br />
Jentsch aus Frankfurt(Oder) und<br />
dessen ebenso resignativem, zugleich<br />
ätzend kritischem „Rotlackiertem<br />
Mäusestaat“. Die Pop-Satirewar<br />
gemünzt auf die DDR –jeder<br />
Arbeitsplatz, jedes private Örtchen<br />
ein Kampfplatz für den Weltfrieden.<br />
VonClemens Haustein<br />
Ein letztes Malnoch spielt die Potsdamer<br />
Winteroper im Ausweichquartier,<br />
in der Friedenskirche am<br />
Rande des Schlossparks von Sanssouci.<br />
Im nächsten November soll sie<br />
wieder zurückkehren an den alten<br />
Ort, das dann hoffentlich fertig renovierte<br />
Schlosstheater im Neuen Palais<br />
am gegenüberliegenden Ende des<br />
Parks. Mozarts „La clemenza di Tito“<br />
soll dann aufgeführt werden, geleitet<br />
vonAlte-Musik-Urgestein Trevor Pinnock.<br />
Noch steht ein klein gedrucktes<br />
„Änderungen vorbehalten!“ unter der<br />
Ankündigung. Aber das bezieht sich<br />
bestimmt nur auf das Programm.<br />
Potsdam ist ja nicht Berlin.<br />
Dieses Jahr also noch einmal,<br />
dem Spielort angemessen, ein geistliches<br />
Stück: Georg Friedrich Händels<br />
Oratorium „Theodora“, ein<br />
Werk,das selten gespielt wird, in Berlin<br />
aber vor zwei Jahren vom Rias-<br />
Kammerchor schon einmal aufgeführt<br />
wurde. Schon Händels Zeitgenossen<br />
stießen sich an der demonstrativ<br />
vorgeführten Opferlust der<br />
beiden Hauptfiguren, der Christin<br />
Theodora und dem von ihr bekehrten<br />
römischen Offizier Didymus.<br />
Beide müssen schließlich sterben,<br />
verurteilt durch den römischen<br />
Statthalter Valens, der sie erfolglos<br />
zur Anbetung seiner römischen Götter<br />
zwingen wollte. Und sie wollen<br />
auch sterben im Wissen, dass „Drüben“<br />
das viel bessere Leben wartet.<br />
Eine Sichtweise, die zu Händels Zeit<br />
offenbar schon unpopulär war −das<br />
Stück wurde schon nach zwei Aufführungen<br />
wieder abgesetzt −und<br />
die uns heute nicht weniger fremd<br />
vorkommt.<br />
Weihnachtlicher Schluss<br />
Sabine Hartmannshenn als Regisseurin<br />
versucht dann auch, „Theodora“<br />
als ein Stück der inneren Dramen<br />
in Szene zu setzen. Im Zentrum<br />
die beiden Hauptfiguren, die sich zu<br />
ihrer eskapistisch anmutenden Sicht<br />
auch erst durchringen müssen, dann<br />
der Offizier Septimius,zerrissen zwischen<br />
Pflichterfüllung dem römischen<br />
Statthalter gegenüber und seiner<br />
Sympathie für die unterdrückten<br />
Christen. Rundherum allerhand<br />
heidnischesVolk, das KostümbildnerinEdith<br />
Kollath mit reicher Fantasie<br />
eingekleidet hat. Eine Wave-Gothic-<br />
Truppe präsentiert sich hier, über<br />
und über behangen mit christlichen<br />
Symbolen: Handy-Kettchen in<br />
Fisch-Form, Rosenkränze, Bischofsmützen,<br />
Barockengelchen. Jeder (bis<br />
auf die gläubigen Hauptfiguren)<br />
trägt sein Kreuzchen mit sich herum.<br />
Waseswirklich bedeutet, weiß niemand<br />
mehr.Bis am Ende Bibeln verteilt<br />
werden und die Wave-Gothic-<br />
Leute begierig zu lesen beginnen.<br />
Einrecht weihnachtlicher Schluss.<br />
Dass die Ausstattung in ihrem Lederjacken-und-Sonnenbrillen-Stil<br />
nach einem Operntheater aussieht,<br />
das gern für modern gehalten werden<br />
würde, macht die Sache etwas<br />
ranzig. Freuen darfman sich aber an<br />
den Sängerinnen und Sängern und<br />
ihrer Darstellung: der feine Tenor<br />
Hugo Hymas etwa, der den Offizier<br />
Septimius singt als Mann, der zwischen<br />
Sensibilität und Verhärtung<br />
schwankt; die Sopranistin Ruby Hughes’<br />
mit einer mild strahlenden<br />
Theodora; Countertenor Christopher<br />
Lowrey, der die Rolle des Didymus<br />
trotz schwerer Stiefel mit Noblesse<br />
erfüllt. Freuen darf man sich<br />
erst recht an Händels streichelnder,<br />
schmeichelnder, labender Musik,<br />
die die Kammerakademie Potsdam,<br />
angeleitet von Konrad Junghänel<br />
nicht nur mit Verstand, sondern<br />
auch mit Herz spielt. Das spricht<br />
ganz direkt zum Hörer und wärmt<br />
ihn, wenn es in der Kirche kühler<br />
wird, je länger das Stück dauert. Aber<br />
wersagt schon, dass es in einer Winteroper<br />
warmsein muss?