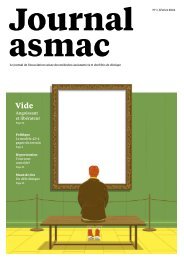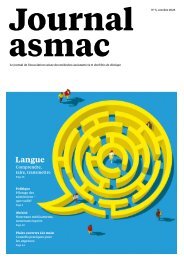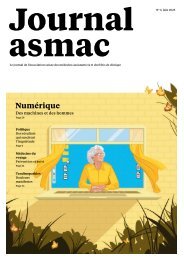VSAO JOURNAL Nr. 5 - Oktober 2020
Raum - Aufräumen, heilen, malen, bloggen Orthopädie - Orthopädische «Kurvendiskussion» Schmerz - Analgetikaunverträglichkeit: Intoleranz oder Allergie? Politik - Neuer vsao-Präsident
Raum - Aufräumen, heilen, malen, bloggen
Orthopädie - Orthopädische «Kurvendiskussion»
Schmerz - Analgetikaunverträglichkeit: Intoleranz oder Allergie?
Politik - Neuer vsao-Präsident
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fokus<br />
Am Nachmittag des 10. Februars<br />
2009 stiess über Sibirien in einer<br />
Höhe von rund 800 Kilometern<br />
der aktive Telefoniesatellit<br />
Iridium 33 mit dem ausgedienten<br />
Kommunikationssatelliten Kosmos 2251<br />
zusammen. Der Aufprall erfolgte mit einer<br />
Geschwindigkeit von 11,7 Kilometern<br />
pro Sekunde und erzeugte eine Trümmerwolke<br />
aus über 2000 Bruchstücken, die<br />
grösser als 10 Zentimeter waren. Innerhalb<br />
weniger Monate breiteten sich diese<br />
Trümmer weiträumig aus und drohen<br />
seither mit weiteren aktiven Satelliten zusammenzustossen.<br />
Dieses Ereignis war ein Weckruf für<br />
sämtliche Satellitenbetreiber, aber auch<br />
für die Politik. Die Problematik von so genanntem<br />
Weltraumschrott (engl. «space<br />
debris») – ausgedienten künstlichen Objekten<br />
im Weltraum – erhielt eine neue Dimension.<br />
Mit der Problematik befassen<br />
sich Experten und Weltraumagenturen<br />
jetzt bereits seit bald 50 Jahren. Schweizer<br />
Forschung liefert die wissenschaftlichen<br />
und empirischen Grundlagen für Modelle<br />
und Massnahmen, um die Anzahl der Objekte<br />
zu stabilisieren, damit auch in Zukunft<br />
eine sichere und nachhaltige Nutzung<br />
des Weltraums möglich ist.<br />
Vor allem Abfall im All<br />
Die Weltraumfahrt hat seit dem Start des<br />
ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1<br />
am 4. <strong>Oktober</strong> 1957 unweigerlich Weltraumschrott<br />
im erdnahen Raum hinterlassen.<br />
Bei jedem Start besteht nur ein<br />
sehr kleiner Teil der in den Weltraum gebrachten<br />
Gesamtmasse aus der aktiven<br />
Nutzlast. Oft wird ein grosser Teil der Masse<br />
innerhalb kurzer Zeit zu Weltraumschrott,<br />
da zum Beispiel die Oberstufe der<br />
Trägerrakete in einer Erdumlaufbahn belassen<br />
wird. Am Ende ihres Lebens wird<br />
auch die eigentliche Nutzlast, falls sie im<br />
Orbit belassen wird, zu Weltraumschrott.<br />
Somit ist es nicht verwunderlich, dass die<br />
derzeit rund 2500 aktiven Satelliten weniger<br />
als 10 Prozent der Gesamtzahl bekannter<br />
künstlicher Objekte, die grösser<br />
als 10 Zentimeter sind, im Weltraum ausmachen.<br />
Die meisten Schrottteile mit Durchmessern<br />
von mehr als einigen Zentimetern<br />
sind Fragmente, welche durch Explosionen<br />
und Kollisionen im Weltraum entstanden<br />
sind. Bis heute haben mehr als 300<br />
solche Ereignisse stattgefunden, darunter<br />
Explosionen von ausgedienten Raketenoberstufen,<br />
Hilfsmotoren und sogar von<br />
Satelliten. Dies kann geschehen, weil sich<br />
etwa Resttreibstoff noch nach vielen Jahren<br />
entzündet oder Batterien in toten<br />
Satelliten überladen werden und auseinanderbrechen.<br />
Bahnen von ca. 25 000 Objekten<br />
bekannt<br />
Um die aktuelle Population von Weltraumschrott<br />
besser zu verstehen, sind<br />
aufwändige Beobachtungen mit bodengestützten<br />
Radaranlagen und optischen<br />
Teleskopen nötig. Mit solchen Messungen<br />
können grössere Objekte regelmässig verfolgt<br />
und ihre Bahnen bestimmt werden.<br />
Heute kennen wir die Bahnen von etwa<br />
25 000 Objekten in Höhen von 300 bis<br />
40 000 Kilometern. Für Teile, die kleiner<br />
als etwa 10 Zentimeter sind, sind nur statistische<br />
Angaben möglich. Die Messungen<br />
deuten auf eine Gesamtzahl von ca.<br />
900 000 Raumschrottobjekten von zwischen<br />
1 und 10 Zentimetern Grösse hin.<br />
Die Teilchen mögen klein sein, sie sind<br />
aber keineswegs ungefährlich: Bei einer<br />
Kollision mit einem Teilchen von einem<br />
Zentimeter Durchmesser wird die Energie<br />
einer explodierenden Handgranate freigesetzt.<br />
In gewissen Bahnbereichen ist das<br />
Risiko für Kollisionen schon heute so<br />
hoch, dass aktive Satelliten regelmässig<br />
Manöver durchführen müssen, um Schrottteilen<br />
auszuweichen. Die Europäische<br />
Weltraumagentur ESA verarbeitet für ihre<br />
Satellitenflotte jede Woche etwa zwei<br />
Kolli sionswarnungen pro Satellit und<br />
führt entsprechend Dutzende von Manövern<br />
pro Jahr durch. Damit lassen sich<br />
zwar Kollisionen mit Objekten, die grösser<br />
als etwa 10 Zentimeter sind, die Satelliten<br />
vollständig zerstören und eine Unzahl von<br />
Bruchstücken erzeugen, verhindern, nicht<br />
aber «tödliche» Einschläge von kleineren<br />
Objekten, deren Bahnen wir nicht kennen.<br />
Für den Satellitenbetreiber wird das Risiko<br />
für die einzelne Mission also nur bedingt<br />
verkleinert, aber – und dies ist entscheidend<br />
– es wird verhindert, dass<br />
Trümmerteile entstehen, die wiederum<br />
mit anderen Objekten kollidieren können<br />
und somit eine verheerende Kettenreaktion<br />
auslösen können. Dieses sogenannte<br />
«Kessler-Syndrom», benannt nach Donald<br />
Kessler, der das Phänomen 1978 als Erster<br />
beschrieben hat, bleibt aber weiterhin eine<br />
Tatsache, da wir zurzeit Kollisionen<br />
zwischen grösseren Raumschrottteilen<br />
nicht verhindern können.<br />
Die Situation wird heute verschärft<br />
durch die extreme Zunahme von Kleinsatelliten,<br />
so startet zum Beispiel die private<br />
Firma SpaceX zurzeit jeden Monat mehr<br />
als 60 Satelliten. In diesem Fall ist das Ziel,<br />
eine sogenannte Konstellation von über<br />
1500 Satelliten zu erstellen, um weltweit<br />
schnelles Internet anzubieten. Andere<br />
Konstellationen mit mehreren Zehntausend<br />
Satelliten sind in Planung. Die Miniaturisierung,<br />
und die damit einhergehenden<br />
Einsparungen bei den Startkosten,<br />
haben es auch Schweizer Firmen und<br />
Universitäten erlaubt, ihre eigenen Kleinsatelliten<br />
in den Weltraum zu bringen.<br />
Auf der Suche nach Raumschrott<br />
Am Astronomischen Institut der Universität<br />
Bern suchen wir mit Teleskopen am<br />
«Swiss Optical Ground Station and Geodynamics<br />
Observatory» in Zimmerwald<br />
bei Bern sowie mit einem Teleskop der<br />
ESA im spanischen Teneriffa nach Raumschrottteilen,<br />
um die aktuelle Population<br />
(Anzahl, Grössen, Objekttypen, Bahnen<br />
usw.) genauer zu verstehen. Wir konzentrieren<br />
uns dabei auf kleine Raumschrottteile<br />
in hohen Erdumlaufbahnen. Neben<br />
den Bahnregionen der Navigationssatelliten<br />
(in ca. 20 000 km Höhe) wird die Region<br />
des so genannten geostationären Rings in<br />
36 000 Kilometern Höhe genauer untersucht.<br />
Dort stehen Satelliten «fest» über<br />
einem Punkt des Äquators und beobachten<br />
immer den gleichen Ausschnitt der<br />
Erdoberfläche (Wettersatelliten), oder sie<br />
strahlen immer in die gleiche Region Signale<br />
aus (Kommunikationssatelliten). Die<br />
<strong>VSAO</strong> /ASMAC Journal 5/20 23