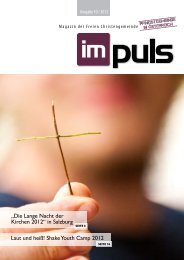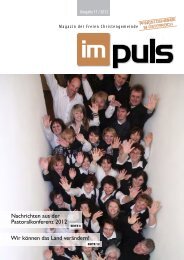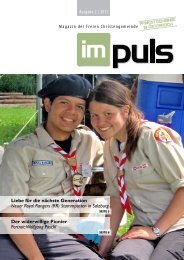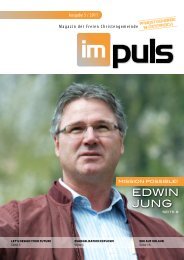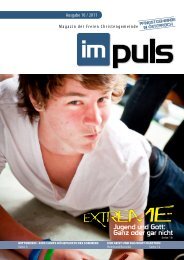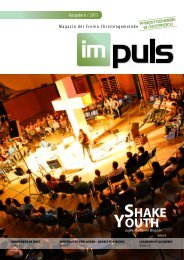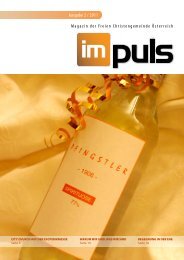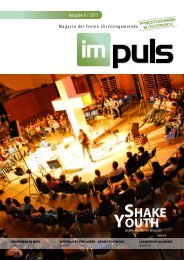Kirchen, Religionen, Bioethik - Freie Christengemeinde
Kirchen, Religionen, Bioethik - Freie Christengemeinde
Kirchen, Religionen, Bioethik - Freie Christengemeinde
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Evangelische <strong>Kirchen</strong><br />
Unter dem Begriff „evangelische <strong>Kirchen</strong>“<br />
werden in der Regel die beiden großen <strong>Kirchen</strong><br />
der evangelisch-lutherischen (Augsburger<br />
Bekenntnis, A.B.) und der evangelischreformierten<br />
(Helvetisches Bekenntnis, H.B.)<br />
verstanden. Beide gingen aus einer Reformbewegung<br />
des 16. Jahrhunderst in Europa aus<br />
der katholischen Kirche hervor und bilden mit<br />
dieser und der Orthodoxie die drei großen<br />
christlichen <strong>Kirchen</strong>familien. Im Folgenden<br />
wird unter „evangelische Kirche“ immer sowohl<br />
jene des Augsburger wie auch jene des<br />
Helvetischen Bekenntnisses verstanden, da<br />
die beiden Religionsgesellschaften in bio- und<br />
medizinethischen Fragen – zumindest in Österreich<br />
– eine gemeinsame Linie vertreten.<br />
Im Mittelpunkt der evangelischen Lehre stehen<br />
die drei Prinzipien: sola scriptura („nur<br />
die Heilige Schrift“ = Bibel); sola gratia („allein<br />
aus göttlicher Gnade“); sola fide („allein<br />
aus dem Glauben“). Damit grenzt sich die<br />
evangelische Kirche insbesondere gegen die<br />
katholische Lehre von der Autorität kirchlicher<br />
Tradition und von der Lehre der guten<br />
Werke ab (Rechtfertigungslehre).<br />
Die Positionen der evangelischen Kirche werden<br />
in der medizin- und bioethischen Debatte<br />
häufig mit jenen der katholischen Kirche zu<br />
einer so genannten „christlichen Position“<br />
zusammen geführt; bei aller gemeinsamen<br />
Tradition und den vielen Parallelen scheint<br />
dies jedoch zu vereinfachend zu sein. Neben<br />
den unterschiedlichen Nuancierungen haben<br />
die beiden Traditionen insbesondere auch<br />
verschiedene philosophische Zugangsweisen<br />
zu den Problemen, so dass es eine Missachtung<br />
der Eigenart der einzelnen <strong>Kirchen</strong> wäre,<br />
wollte man sie vereinheitlichen (in der<br />
Regel zu Lasten der Minderheit, d.h. der evangelischen<br />
Kirche).<br />
In Österreich ist die evangelische Kirche seit<br />
der josephinischen Toleranzgesetzgebung<br />
(1781) geduldet, seit 1861 anerkannt (sowohl<br />
die Evangelische Kirche A.B. als auch die Evangelische<br />
Kirche H.B. und die Evangelische<br />
Kirche A.u.H.B.). Seit 1961 ist die gesetzliche<br />
Kirche, Religione, <strong>Bioethik</strong><br />
Grundlage das Protestantengesetz (BGBl Nr.<br />
182/1961). 2<br />
Grundlegende Fragen<br />
Quellen der Entscheidungsfindung<br />
Die evangelische Kirche kennt vor allem eine<br />
Quelle der Entscheidungsfindung: die Heilige<br />
Schrift (Bibel), für die evangelische Theologen<br />
schon seit Ende des 19. Jahrhunderts<br />
eine differenzierte, kritische Hermeneutik<br />
entwickelt haben.<br />
In ethischen Fragen der Biomedizin ist auch<br />
auf die reichhaltige Tradition westlicher Philosophie<br />
zurück zu greifen, die auch der evangelischen<br />
Ethik zu Grunde liegt. Die evangelische<br />
Kirche ist so offen für den klassischen<br />
und neuzeitlichen philosophischen Dialog<br />
und hat ihn selbst durch zahlreiche Lehrer<br />
weiter voran getrieben.<br />
Zu zentralen Fragen veröffentlicht die evangelische<br />
Kirche so genannte „Denkschriften“,<br />
so auch zu Fragen der Biomedizin („Verantwortung<br />
für das Leben“, Wien 2001); die folgenden<br />
Ausführungen zur evangelischen Position<br />
beziehen sich auf dieses – auch international<br />
beachtete – Papier.<br />
Autoritäten der Entscheidungsfindung<br />
Die evangelische Kirche kennt keine weltumfassende<br />
zentrale Leitung, sondern gliedert<br />
sich in Landeskirchen unter der Leitung eines<br />
Landesbischofs und des Oberkirchenrates. Die<br />
evangelische Kirche hat eine presbyteralsynodale<br />
<strong>Kirchen</strong>verfassung (d.h. Gemeindeleitung<br />
durch Presbyter, <strong>Kirchen</strong>leitung durch<br />
Synoden) mit demokratischen Elementen<br />
(Wahlen).<br />
Für die Entscheidungsfindung der zuständigen<br />
Autoritäten sind insbesondere auch wissenschaftliche<br />
Stellungnahmen erforderlich. Diese<br />
kommen – was die Theologie und Philosophie<br />
betrifft – in Österreich in erster Linie<br />
von der Evangelisch-theologischen Fakultät<br />
der Universität Wien.<br />
Anders als in der katholischen Kirche, bei der<br />
die umfassende und unmittelbare Lehr- und<br />
Leitungsgewalt beim Diözesanbischof in per-<br />
2 Die Darstellung der evangelischen Positionen erfolgt<br />
größtenteils auf Basis der von Herrn Univ.-Prof. Dr.<br />
Ulrich Körtner verfassten einschlägigen Denkschrift<br />
„Verantwortung für das Leben“ (2001).<br />
13