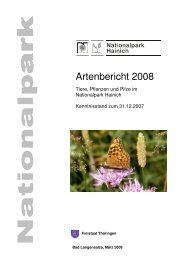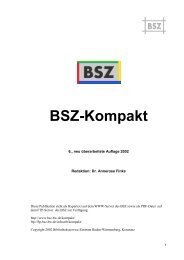Die Thematisierung von Tod und Trauer. - d-nb, Archivserver ...
Die Thematisierung von Tod und Trauer. - d-nb, Archivserver ...
Die Thematisierung von Tod und Trauer. - d-nb, Archivserver ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.widerstreit-sachunterricht.de/Ausgabe Nr. 7/Oktober 2006<br />
bleibt als einzige Sicherheit: Es gibt ein Leben vor dem <strong>Tod</strong>“ (ebd., S. 140/141). Karin Huck <strong>und</strong><br />
Hilarion Petzold formulieren die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem <strong>Tod</strong> als mögliche Hilfe<br />
auf drei Ebenen – der individuellen, der institutionellen 20 <strong>und</strong> der gesellschaftlichen (vgl.<br />
Huck/Petzold 1984, S. 504). Erstere <strong>und</strong> letztere sind im Kontext dieser Arbeit besonders interessant.<br />
<strong>Die</strong> Auseinandersetzung mit dem <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> damit auch der <strong>Trauer</strong> werden als „universelle Entwicklungsaufgabe<br />
<strong>und</strong> [...] [nicht als] isoliertes Katastrophen-Ereignis“ (ebd.) verstanden. Demnach könnte<br />
eine solche Auseinandersetzung, Einfluss auf das ‚eigene Leben‘ haben, indem sie dabei hilft, eine<br />
eigene Lebensphilosophie zu entwickeln. „Sie trägt dazu bei, [...] [die eigene] Identität in prägnanter<br />
Weise zu erleben; denn Identität wird in Abgrenzung <strong>und</strong> Kontakt gewonnen.“ (ebd., S. 505) Langfristig<br />
betrachtet könnte dies zu einem selbstverständlicheren <strong>und</strong> offeneren Umgang mit <strong>Tod</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Trauer</strong> in der Gesellschaft führen <strong>und</strong> somit zu einer stärkeren Wertschätzung des ‚eigenen Lebens‘<br />
(vgl. ebd.).<br />
Zudem ist nicht abzustreiten, dass Kinder ein Interesse an diesen Themen haben <strong>und</strong> dieses nach<br />
Klafki gefördert werden sollte beziehungsweise auch Bestandteil seiner inhaltlichen Festlegung auf<br />
die Schlüsselprobleme ist. Dem Bildungsauftrag des Sachunterrichts entsprechend sollten <strong>Tod</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Trauer</strong> demnach Themen des Sachunterrichts sein, da sie den Bildungszielen desgleichen entsprechendes<br />
Potential bergen <strong>und</strong> zu einer Identitätsentwicklung im Sinne der ersten Bildungsdimension<br />
Klafkis – Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- <strong>und</strong> Solidaritätsfähigkeit – beitragen können.<br />
<strong>Die</strong>ses zeigen auch die dargestellten Unterrichtsvorschläge, wie zum Beispiel der <strong>von</strong> Biesentahl<br />
<strong>und</strong> Ciftci auf. <strong>Die</strong> Kinder konnten sich in hohem Maße mit dem gleichaltrigen Mädchen identifizieren<br />
<strong>und</strong> waren zur Empathie fähig, indem sie sich vorstellten, wie diese sich während ihrer Krankheit<br />
fühlte. Zudem wurden ihre eigenen Interessen <strong>und</strong> Erfahrungen mit zum Gegenstand des Unterrichts.<br />
Es wurde mit großer Offenheit über unterschiedliche Vorstellungen ‚philosophiert‘ <strong>und</strong> die Kinder<br />
konnten selbst entscheiden, was sie glauben wollten. Außerdem wurden mögliche <strong>Trauer</strong>reaktionen<br />
besprochen, um den Kindern zu verdeutlichen, dass im Sinne der Vielschichtigkeit <strong>von</strong> <strong>Trauer</strong> alles<br />
erlaubt ist (vgl. Biesenthal/Ciftci 2003, S. 37/38).<br />
<strong>Die</strong> Einheit <strong>von</strong> Lesemann <strong>und</strong> Stei<strong>nb</strong>rinker scheint ebenso durch ein hohes Maß an Offenheit gegenüber<br />
den Fragen der Kinder sehr effektiv gewesen zu sein. <strong>Die</strong> dargestellten Unterrichtserfahrungen<br />
aus dem Religionsunterricht dagegen sind eher negativ zu bewerten, was daran liegen könnte,<br />
dass eine bestimmte Vorstellung <strong>von</strong> <strong>Tod</strong> diesem Unterricht zu Gr<strong>und</strong>e liegt. Wenn die <strong>Thematisierung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> im Religionsunterricht erfolgreich sein soll, muss den Kindern, die in diesem<br />
Alter noch Schwierigkeiten haben zu abstrahieren <strong>und</strong> dann eher dazu neigen zu fantasieren, sehr<br />
deutlich gemacht werden, dass es sich im Religionsunterricht um Glaubenssätze handelt, die nicht mit<br />
konkreten Realvorstellungen zu vergleichen sind. <strong>Die</strong> Lehrkräfte dürfen in diesem Fall nicht da<strong>von</strong><br />
ausgehen, dass Kinder diesen Abstraktionsprozess ohne weiteres vollziehen können.<br />
Völlerings Kritik an der Einheit <strong>von</strong> Plieth u. a. zeigt sehr deutlich, was in einem Fachunterricht,<br />
insbesondere im Religionsunterricht, kritisch zu betrachten ist. <strong>Die</strong> Kinder werden in diesem Unterricht<br />
zum Glauben erzogen, das heißt zu einem bestimmten Glaubensverständnis, welches in Bezug<br />
auf das evangelische <strong>Tod</strong>esverständnis der Auferstehungsglauben ist. <strong>Die</strong>ser Glauben kann eine Hilfe,<br />
im Sinne <strong>von</strong> Hoffnung, bedeuten. Dennoch müssen meines Erachtens die <strong>Tod</strong>eskonzepte der Kinder<br />
berücksichtigt werden <strong>und</strong> bei einer <strong>Thematisierung</strong> im Religionsunterricht in ein solches Glaubensverständnis<br />
integriert werden. Hier wird die <strong>Thematisierung</strong> insofern sinnlos, wenn versucht wird, den<br />
Kindern Lebenssinn im Sinne des Auferstehungsglaubens zu vermitteln, indem ihre eigenen Vorstellungen<br />
<strong>und</strong> Erfahrungen übergangen werden <strong>und</strong> stattdessen versucht wird, ihnen ein ‚Patentrezept‘ in<br />
Form einer Lösung – das Paradies – vorzugeben. Ein qualitativer Religionsunterricht bezüglich der<br />
Themen <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> kann durchaus sinngebend sein, er darf jedoch nie die Fragen <strong>und</strong> Vorstellungen<br />
der Kinder übergehen.<br />
Weitere Schwachpunkte der ausschließlichen <strong>Thematisierung</strong> des Themas <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> im Religionsunterricht,<br />
stellt auch Reuter fest. Sie bezweifelt, dass in einer Gesellschaft, in der Religion<br />
immer weniger eine Rolle zu spielen scheint, in der Kinder kaum noch religiös erzogen werden, es<br />
ausreichen könnte so komplexe Themen, wie <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> ausschließlich dort zu thematisieren<br />
(vgl. Reuter 1994, S. 152).<br />
<strong>Die</strong>se Meinung wird auch, ausgehend <strong>von</strong> den in Kapitel 1 versuchten Begriffsklärungen, in dieser<br />
Arbeit vertreten. Themen wie <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong>, die viele Fragen in noch mehr verschiedene Richtun-<br />
20 <strong>Die</strong> Auseinandersetzung mit <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> könnte einigen „Berufsgruppen, die häufig mit dem <strong>Tod</strong> konfrontiert sind, wie z.<br />
B. Mediziner, Pflegepersonal oder Psychotherapeuten, könnte zu einer persönlichen Entlastung <strong>und</strong> Offenheit gegenüber Sterbenden<br />
<strong>und</strong> Angehörigen versus einer Sprachlosigkeit <strong>und</strong> Routine führen“ (Petzold/Huck 1984, S. 505).<br />
29