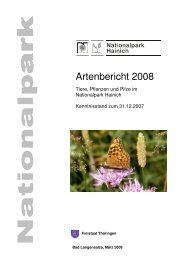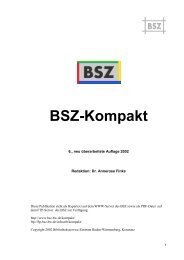Die Thematisierung von Tod und Trauer. - d-nb, Archivserver ...
Die Thematisierung von Tod und Trauer. - d-nb, Archivserver ...
Die Thematisierung von Tod und Trauer. - d-nb, Archivserver ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.widerstreit-sachunterricht.de/Ausgabe Nr. 7/Oktober 2006<br />
2 Warum sollen ‚Phänomene‘ wie <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> in der Gr<strong>und</strong>schule thematisiert werden?<br />
<strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> sind u<strong>nb</strong>estreitbar Themen beziehungsweise ‚(Bestand-)Teile‘ unserer Gesellschaft.<br />
Wir werden fast täglich mit dem <strong>Tod</strong> konfrontiert, sei es durch Medien, alltägliche Erlebnisse – beispielsweise<br />
mit Tieren oder Pflanzen oder im persönlichen Umfeld. Kinder sind auch ‚Teile‘ dieser<br />
Gesellschaft. Demzufolge werden sie genauso wie Erwachsene fast täglich mit dem <strong>Tod</strong> konfrontiert<br />
<strong>und</strong> trotzdem <strong>von</strong> den Erwachsenen all zu oft <strong>von</strong> <strong>Trauer</strong>prozessen ausgeschlossen. <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong><br />
sind demnach automatisch Teile <strong>von</strong> Kindheit. Dabei stellt sich die Frage, wieso sie nicht Themen der<br />
Gr<strong>und</strong>schule sind, die Kindern beim ‚Entschlüsseln‘ der Welt helfen soll?<br />
Um dieser Frage nachzugehen, wird in den folgenden Kapiteln beschrieben, welche Entwicklungstendenzen<br />
es in unserer Gesellschaft in Bezug auf die Themen <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> gibt. Weiterhin wird<br />
erörtert, welchen Einfluss das diesbezügliche Verhalten innerhalb unserer Gesellschaft auf Kinder<br />
haben kann. Anschließend wird geprüft, inwieweit Kinder den <strong>Tod</strong> ‚be-greifen‘ können <strong>und</strong> ob sie,<br />
z.B. in Bezug auf die Definition <strong>von</strong> <strong>Trauer</strong>prozessen nach Kübler-Ross (1978) zur <strong>Trauer</strong>, fähig sind.<br />
2.1 Entwicklungstendenzen <strong>und</strong> Umgang mit den Themen <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> in unserer<br />
Gesellschaft<br />
Im Folgenden werden an Hand ausgewählter Punkte – demographische Veränderung, Krankheit, Institutionalisierung<br />
<strong>und</strong> Riten – aktuelle Entwicklungen in unserer Gesellschaft zum Umgang mit <strong>Tod</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> dargestellt.<br />
2.1.1 Demographische Veränderungen<br />
In Deutschland wird seit 1871/1881 die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung evaluiert.<br />
Sie betrug zu diesem Zeitpunkt für einen neugeborenen Jungen 35,6 Jahre <strong>und</strong> für ein Mädchen 38,5<br />
Jahre. <strong>Die</strong> neusten Berechnungen der Jahre 2001 bis 2003 beschreiben die durchschnittliche Lebenserwartung<br />
<strong>von</strong> neugeborenen Jungen mit 75,6 Jahren <strong>und</strong> die eines neugeborenen Mädchens mit 81,3<br />
Jahren. Das heißt die Lebenserwartungen haben sich im Verlauf <strong>von</strong> ca. 120 Jahren mehr als verdoppelt.<br />
<strong>Die</strong> Gründe dieser Entwicklung sind in einer besseren Ernährung <strong>und</strong> Hygiene, verbesserten<br />
Wohnsituationen <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen, vor allem aber in der fortgeschrittenen medizinischen<br />
Versorgung zu finden (vgl. Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2004, S. 10).<br />
Demzufolge starben früher mehr Säuglinge <strong>und</strong> Kinder, beziehungsweise junge Menschen. Heute<br />
wird „der <strong>Tod</strong> eines Kindes [...] als außergewöhnlich, widernatürlich <strong>und</strong> katastrophal erlebt“ (Lammer<br />
2003, S. 40). Der <strong>Tod</strong> wird im engeren Kreis der Familie durchschnittlich nur noch alle 15 bis 20<br />
Jahre erlebt. <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> Sterben entziehen sich somit dem Bewusstsein der Menschen, mit der Folge,<br />
dass deren Bewältigung immer weniger ‚geübt‘ werden kann (vgl. ebd.). Der Umgang mit dem Leichnam<br />
<strong>und</strong> die Begleitung eines Sterbenden gehören nicht mehr zu den gewohnten Verhaltensweisen<br />
heutiger Familien (vgl. Freese 2001, S. 10).<br />
Norbert Elias schlussfolgerte schon 1982: „In einer Gesellschaft mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung<br />
<strong>von</strong> fünf<strong>und</strong>siebzig Jahren liegt der <strong>Tod</strong> für einen zwanzigjährigen, selbst für einen<br />
dreißigjährigen Menschen ganz erheblich ferner als in einer Gesellschaft mit einer durchschnittlichen<br />
Lebenserwartung <strong>von</strong> vierzig Jahren“ (Elias 2002, S. 50).<br />
2.1.2 <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Trauer</strong> – eine Krankheit?<br />
Durch den medizinischen Fortschritt wird der <strong>Tod</strong> nicht mehr als natürliches Ereignis <strong>und</strong> somit als<br />
etwas U<strong>nb</strong>eeinflussbares gesehen, sondern als Ereignis, welches steuerbar ist – zum Beispiel durch<br />
Operationen <strong>und</strong> Medikamente. Der <strong>Tod</strong> wird demnach als zu bekämpfende Krankheit betrachtet (vgl.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2005). Auch <strong>Trauer</strong> wird in unserer Gesellschaft oft als etwas Krankhaftes<br />
gesehen, etwas das es zu bekämpfen gilt. Jemand der trauert, wird ständig aufgefordert, wieder fröhlich<br />
zu sein. Dabei wird übersehen, dass <strong>Trauer</strong> eine lebenswichtige Funktion unseres Organismus ist<br />
(vgl. Canacakis 2002, S. 24).<br />
In diesem Kontext kann es auch dazu kommen, dass ein Arzt für den <strong>Tod</strong> eines Menschen verantwortlich<br />
gemacht wird (vgl. Callahan 1998, S. 77/78). „Unter dem Erwartungsdruck, die Sterblichkeit<br />
zu besiegen, hat die Medizin ihr Verhältnis zur Natur verzerrt; [...].“ (ebd., S. 69) Sie stellt den <strong>Tod</strong><br />
als etwas Korrigierbares dar (vgl. ebd., S. 69/70). „Der Gedanke an die Unerbittlichkeit der Naturabläufe<br />
wird durch den ihrer Kontrollierbarkeit gemildert.“ (Elias 2002, S. 51/52)<br />
Im Sterben liegende Menschen werden häufig mit Medikamenten in einen ‚Trancezustand‘ versetzt.<br />
Während die Menschen früher Verletzungen <strong>und</strong> Erkrankungen ertragen <strong>und</strong> mit dem <strong>Tod</strong> rech-<br />
9