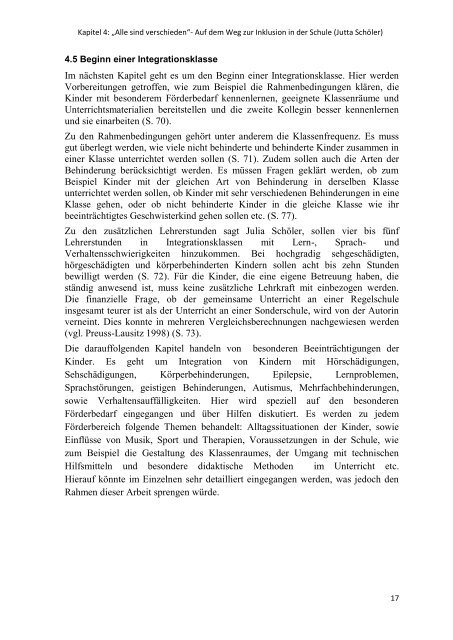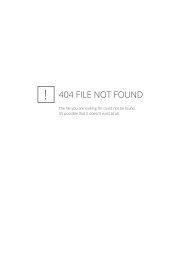hier - Herbert Bruhn
hier - Herbert Bruhn
hier - Herbert Bruhn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitel 4: „Alle sind verschieden“- Auf dem Weg zur Inklusion in der Schule (Jutta Schöler)<br />
4.5 Beginn einer Integrationsklasse<br />
Im nächsten Kapitel geht es um den Beginn einer Integrationsklasse. Hier werden<br />
Vorbereitungen getroffen, wie zum Beispiel die Rahmenbedingungen klären, die<br />
Kinder mit besonderem Förderbedarf kennenlernen, geeignete Klassenräume und<br />
Unterrichtsmaterialien bereitstellen und die zweite Kollegin besser kennenlernen<br />
und sie einarbeiten (S. 70).<br />
Zu den Rahmenbedingungen gehört unter anderem die Klassenfrequenz. Es muss<br />
gut überlegt werden, wie viele nicht behinderte und behinderte Kinder zusammen in<br />
einer Klasse unterrichtet werden sollen (S. 71). Zudem sollen auch die Arten der<br />
Behinderung berücksichtigt werden. Es müssen Fragen geklärt werden, ob zum<br />
Beispiel Kinder mit der gleichen Art von Behinderung in derselben Klasse<br />
unterrichtet werden sollen, ob Kinder mit sehr verschiedenen Behinderungen in eine<br />
Klasse gehen, oder ob nicht behinderte Kinder in die gleiche Klasse wie ihr<br />
beeinträchtigtes Geschwisterkind gehen sollen etc. (S. 77).<br />
Zu den zusätzlichen Lehrerstunden sagt Julia Schöler, sollen vier bis fünf<br />
Lehrerstunden in Integrationsklassen mit Lern-, Sprach- und<br />
Verhaltensschwierigkeiten hinzukommen. Bei hochgradig sehgeschädigten,<br />
hörgeschädigten und körperbehinderten Kindern sollen acht bis zehn Stunden<br />
bewilligt werden (S. 72). Für die Kinder, die eine eigene Betreuung haben, die<br />
ständig anwesend ist, muss keine zusätzliche Lehrkraft mit einbezogen werden.<br />
Die finanzielle Frage, ob der gemeinsame Unterricht an einer Regelschule<br />
insgesamt teurer ist als der Unterricht an einer Sonderschule, wird von der Autorin<br />
verneint. Dies konnte in mehreren Vergleichsberechnungen nachgewiesen werden<br />
(vgl. Preuss-Lausitz 1998) (S. 73).<br />
Die darauffolgenden Kapitel handeln von besonderen Beeinträchtigungen der<br />
Kinder. Es geht um Integration von Kindern mit Hörschädigungen,<br />
Sehschädigungen, Körperbehinderungen, Epilepsie, Lernproblemen,<br />
Sprachstörungen, geistigen Behinderungen, Autismus, Mehrfachbehinderungen,<br />
sowie Verhaltensauffälligkeiten. Hier wird speziell auf den besonderen<br />
Förderbedarf eingegangen und über Hilfen diskutiert. Es werden zu jedem<br />
Förderbereich folgende Themen behandelt: Alltagssituationen der Kinder, sowie<br />
Einflüsse von Musik, Sport und Therapien, Voraussetzungen in der Schule, wie<br />
zum Beispiel die Gestaltung des Klassenraumes, der Umgang mit technischen<br />
Hilfsmitteln und besondere didaktische Methoden im Unterricht etc.<br />
Hierauf könnte im Einzelnen sehr detailliert eingegangen werden, was jedoch den<br />
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.<br />
17