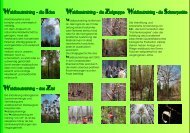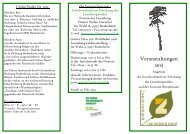Solarthermie für das Bodelschwingh Zentrum Meisenheim
Solarthermie für das Bodelschwingh Zentrum Meisenheim
Solarthermie für das Bodelschwingh Zentrum Meisenheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Machbarkeitsstudie: <strong>Bodelschwingh</strong> <strong>Zentrum</strong><br />
Die darüber hinaus bei mehreren Begehungen gewonnenen Daten, wurden in der unten<br />
folgenden Beschreibung der einzelnen Gebäude festgehalten. Dabei wurde versucht<br />
möglichst viele Informationen zu folgenden Punkten zu sammeln:<br />
• <strong>das</strong> Gebäude allgemein (Nutzung, Anzahl Bewohner/Mitarbeiter)<br />
• Dach (Beschaffenheit, Verschattung)<br />
• Ort <strong>für</strong> die Aufstellung der Speicher<br />
• mögliche Varianten <strong>für</strong> die Rohr- bzw. Kanalverlegung vom Kollektor bis zum<br />
Speicherstandort<br />
Die Hauswände wurden auch auf eine mögliche Anbringung von Solarkollektoren geprüft,<br />
aber die weitere Betrachtung beschränkt sich auf die Dachmontage der Kollektoren. Weiterhin<br />
wurden von den <strong>für</strong> die Anlageninstallation relevanten Bereichen Bilder gemacht<br />
und auch teilweise in diese Arbeit eingebunden. Weitere Fotos sind auf der CD zu finden.<br />
3.1.1 <strong>Bodelschwingh</strong> <strong>Zentrum</strong><br />
Alle Gebäude des <strong>Zentrum</strong>s wurden in den Jahren 1978 und 1979 nach dem Skelettbauverfahren<br />
errichtet. Bei dieser Bauweise wird „die tragende Konstruktion, bestehend aus<br />
Stützen, Unterzügen und Deckenträgern in Holz, Stahl oder Stahlbeton errichtet [...]. Die<br />
nichttragenden Wände werden später mit Mauerwerk oder Sandwichplatten ausgefacht.“ 21<br />
Die Dämmung der Bauwerke erfolgte zum einen durch den zur Errichtung der Außenwände<br />
verwendeten Porenbeton und zum anderen durch die an den Wänden angebrachten<br />
Gipskarton- und Styroporplatten. Bei einigen der Gebäude erfolgte die Dämmung der Außenwand<br />
zusätzlich noch mittels einer Vorhangfassade.<br />
Sämtliche Gebäude wurden anfänglich mit einem Flachdach, welches nach dem<br />
Umkehrdachprinzip aufgebaut ist, ausgestattet, d. h. die Schichten der Dachabdichtung<br />
und der Isolierung liegen in umgekehrter Reihenfolge als bei einem konventionellen<br />
Flachdach. Da die Dachabdichtung und -dämmung schon 28 Jahre alt sind und Mängel<br />
aufweisen, stehen Sanierungsmaßnahmen an bzw. wurden zum Teil auch schon durchgeführt.<br />
Dabei wurde <strong>das</strong> Dämmmaterial bei den Häusern 8 und 14, welches sich mit<br />
Wasser vollgesogen hatte und somit <strong>für</strong> eine Verschlechterung der Wärmedämmung<br />
sorgte, ausgetauscht und unter die Dachabdichtung verlegt. Eine Installation einer Solaranlage<br />
auf dem Dach ist nur nach einer abgeschlossenen Sanierung sinnvoll. Da die Anlagen<br />
mindestens 20 Jahre auf dem Dach stehen bleiben werden, sollte daher die Sanie-<br />
21 vgl. www.architektur-lexikon.de/lexikon/skelettbau.htm, 29.03.2007, 12:37 Uhr<br />
11