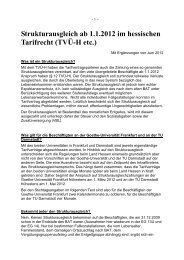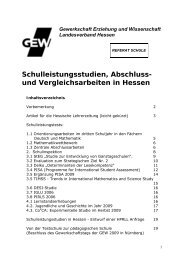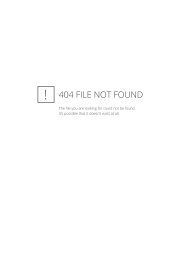Eine Schule für Mädchen und Jungen - GEW - Berlin
Eine Schule für Mädchen und Jungen - GEW - Berlin
Eine Schule für Mädchen und Jungen - GEW - Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Man wird nicht als Frau geboren, zur<br />
Frau wird man gemacht.“<br />
(Simone de Beauvoir) – Die konstruktivistische<br />
Sichtweise<br />
Berechtigte Zweifel an der „Zweigeschlechtlichkeit<br />
der Welt“ (Koch-Priewe 2002, S. 19) führten<br />
vor allem in den 1990er Jahren auch zu<br />
konstruktivistisch orientierten Theorieansätzen.<br />
Die Fragestellung des Konstruktivismus ist<br />
nicht mehr: Wie soll in der Gesellschaft mit<br />
der Verschiedenheit der Geschlechter umgegangen<br />
werden? Sondern eher: Auf welche Art<br />
<strong>und</strong> Weise wird Geschlecht überhaupt zugewiesen?<br />
<strong>Eine</strong>ngende Verhaltenszuweisungen<br />
sollten als solche entlarvt <strong>und</strong> vermieden werden.<br />
Dabei wurde zunächst die englische<br />
Unterscheidung von „Sex“ <strong>und</strong> „Gender“ in<br />
den deutschen Sprachgebrauch übernommen,<br />
um deutlich zu machen, dass das biologische<br />
Geschlecht („Sex“) nicht mit den ihm zugewiesenen<br />
sozialen Merkmalen identisch ist.<br />
Ein radikal verstandener Konstruktivismus<br />
lehnt sogar die Vorstellung eines biologischen<br />
Geschlechts überhaupt ab <strong>und</strong> vertritt die Position,<br />
dass jede Form von Geschlecht konstruiert<br />
sei, also unter den Begriff „Gender“ gefasst<br />
werden könnte (vgl. Butler 1991). Für konkrete<br />
Situationen innerhalb des Schulkontexts<br />
scheint es jedoch nicht praktikabel, gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
an der Negierung eines biologischen Geschlechts<br />
anzusetzen. Wichtiger erscheint die<br />
Tatsache, dass durch die Betonung von Geschlechterunterschieden<br />
diese (z.T. immer<br />
noch hierarchisch konnotierten) Unterschiede<br />
geradezu verfestigt werden können. Betont also<br />
beispielsweise eine Lehrerin mit besten Absichten<br />
das besonders gute Sozialverhalten der<br />
<strong>Mädchen</strong>, so wird damit eine ganz bestimmte<br />
Rolle eben der <strong>Mädchen</strong> bestärkt, die auch<br />
Nachteile <strong>für</strong> diese Gruppe mit einschließt<br />
(z.B. <strong>Mädchen</strong> als ‚Sozialschmiere’ in der Klasse).<br />
In diesem Fall hat das vermeintlich geschlechtersensible<br />
Verhalten eine Verstärkung<br />
von Geschlechterstereotypen zur Folge. Allerdings<br />
hat sich schon nach der Einführung der<br />
Koedukation in den 1960er Jahren gezeigt,<br />
dass durch unreflektiertes Nebeneinander-<br />
Unterrichten keine Geschlechtergerechtigkeit<br />
hergestellt werden kann.<br />
Wichtig bleibt, sich bewusst zu machen,<br />
dass Geschlechterverhalten nicht angeboren<br />
<strong>und</strong> unveränderlich, sondern vom Umfeld<br />
der Beteiligten zugewiesen <strong>und</strong> daher<br />
wandelbar ist.<br />
Doing Gender – Doing Student<br />
Der Begriff „Gender“ ist daher in der Diskussion<br />
um geschlechterabhängige Unterschiede<br />
in der <strong>Schule</strong> sinnvoll. Wie können wir uns<br />
„Gendering“ genauer vorstellen? Hannelore<br />
Faulstich-Wieland zeichnet diesen Vorgang aus<br />
sozialisationstheoretischer Sicht nach (vgl.<br />
Faulstich-Wieland 2003, S. 116-123): Kindern<br />
wird mit der Geburt eines von zwei Geschlechtern<br />
zugewiesen, dass schon im Krankenhaus<br />
oft zum Beispiel durch ein rosa oder hellblaues<br />
Armband gekennzeichnet wird. Im folgenden<br />
Sozialisationsprozess muss sich nun das<br />
<strong>Mädchen</strong> bzw. der Junge aneignen, was diese<br />
Zuordnung bedeutet. Der Geschlechtszugehörigkeit<br />
wird Kontinuität verliehen, indem sich<br />
z.B. der Junge gegenüber anderen wieder als<br />
Junge inszeniert <strong>und</strong> gleichzeitig seinem<br />
Gegenüber Gleichgeschlechtlichkeit zuschreibt.<br />
Damit hat der Junge nicht einfach ein Geschlecht,<br />
sondern er weist es sich <strong>und</strong> anderen<br />
immer wieder zu. Diese ständige Zuweisung ist<br />
1. <strong>Jungen</strong> <strong>und</strong> <strong>Mädchen</strong> in der <strong>Schule</strong> – <strong>Eine</strong> kleine Einführung<br />
17