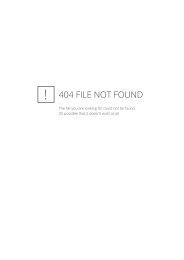Textsemantische Grundlagen der Analyse von Musikszenen und ...
Textsemantische Grundlagen der Analyse von Musikszenen und ...
Textsemantische Grundlagen der Analyse von Musikszenen und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Auch die Frage, ob kommentative, kontrapunktische o<strong>der</strong> ironische<br />
Beziehungen zwischen Handlung/Figur/Bild <strong>und</strong> Musik intradiegetisch<br />
aufgebaut werden können, bleibt zu diskutieren, wenngleich man sich ohne<br />
Schwierigkeiten Beispiele vorstellen kann, die zeigen, dass dieses sehr wohl<br />
<strong>der</strong> Fall sein kann. 11<br />
Es gibt ein starkes Argument dafür, dass die Differenz zwischen intra- <strong>und</strong><br />
extradiegetischer Musik rezeptionsästhetisch <strong>von</strong> einigem Belang ist – sie<br />
ist unter Umständen nämlich wahrnehmungsauffällig. Wechselt eine Musik<br />
den diegetischen Ort, antwortet <strong>der</strong> Zuschauer mit einem Lacher (den man<br />
wie<strong>der</strong>um als Hinweis auf ein momentanes reflexives Aha-Erlebnis<br />
verstehen darf; die Beispiele entstammen darum auch fast alle <strong>der</strong><br />
Komödie). In Robert Bentons KRAMER VERSUS KRAMER (KRAMER<br />
GEGEN KRAMER, USA 1979) ertönt Vivaldi'sche Lautenmusik. Sie wirkt<br />
wie fröhliche Begleitmusik; als <strong>der</strong> Held aber die Straße weiter<br />
hinuntergeht, erweist sie sich als diegetische Musik, die <strong>von</strong> zwei<br />
Straßenmusikern veranstaltet wird. In Mel Brooks‘ SILENT MOVIE (USA<br />
1976) fährt ein ganzer Bus, vollbesetzt mit einem mexikanischen Orchester,<br />
durchs Bild, wie<strong>der</strong>um die Musik diegetisierend, die man bis dahin als reine<br />
Gärtners, sublimiert ihn vielleicht. Eine Kitsch-Strategie, sicherlich. Aber hat man<br />
damit erfasst, welche Bedeutungsprozesse hier greifen können? [...] Die<br />
Vorstellungsmodelle des Todes, die im Film ausgefaltet sind, umfassen sehr oft eine<br />
Art <strong>von</strong> Überhöhung des Todes in die Sphären des Ästhetischen o<strong>der</strong> Rhetorischen<br />
hinein. Pathos <strong>und</strong> Süsslichkeit sind nur zwei Extrempunkte in einer langen Kette<br />
<strong>von</strong> Alternativen. Tod ist die definitive Aufkündigung <strong>der</strong> Teilhabe am Diegetischen.<br />
Es mag sein, dass <strong>der</strong> so regelmäßige Einsatz <strong>von</strong> Musiken in Todesszenen mit einer<br />
Modulation <strong>der</strong> Diegese zu tun hat, dass er also auf einer eigentlich formalen<br />
Operation beruht« (Brief an Mirkko Stehn, 12.9.2007).<br />
11 Auch Gorbman (1987, 23) plädiert dafür, die Differenz zwischen den beiden Arten<br />
<strong>von</strong> Musik nicht zu groß zu machen – auch diegetische Musik kann dramatische<br />
Spannung erzeugen o<strong>der</strong> unterstreichen, auch sie kann <strong>der</strong> Psychologie <strong>der</strong> Figuren<br />
Ausdruck verleihen, auch sie kann – vor allem in Komödien – ironisch o<strong>der</strong> burlesk<br />
wirken (1987, 78). Vgl. dazu auch Reay 2004, 34, passim.<br />
Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung, 9, 2013 // 244