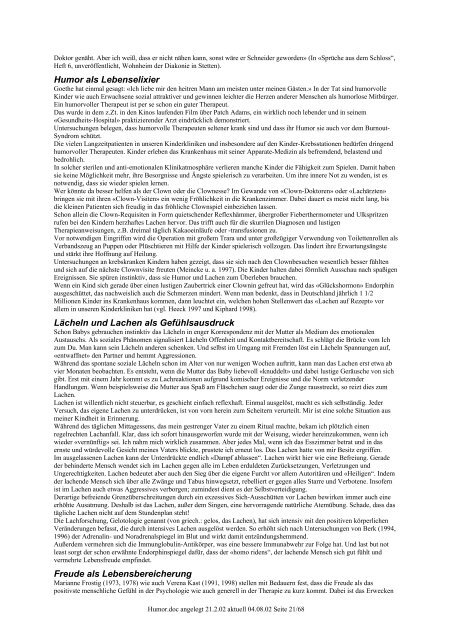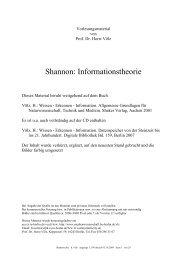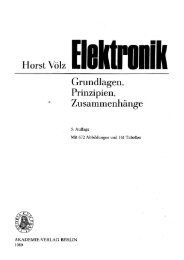Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Doktor genäht. Aber ich weiß, dass er nicht nähen kann, sonst wäre er Schneider geworden» (In «Sprüche aus dem Schloss“,<br />
Heft 6, unveröffentlicht, Wohnheim der Diakonie in Stetten).<br />
<strong>Humor</strong> als Lebenselixier<br />
Goethe hat einmal gesagt: «Ich liebe mir den heitren Mann am meisten unter meinen Gästen.» In der Tat sind humorvolle<br />
Kinder wie auch Erwachsene sozial attraktiver und gewinnen leichter die Herzen anderer Menschen als humorlose Mitbürger.<br />
Ein humorvoller Therapeut ist per se schon ein guter Therapeut.<br />
Das wurde in dem z.Zt. in den Kinos laufenden Film über Patch Adams, ein wirklich noch lebender und in seinem<br />
«Gesundheits-Hospital» praktizierender Arzt eindrücklich demonstriert.<br />
Untersuchungen belegen, dass humorvolle Therapeuten seltener krank sind und dass ihr <strong>Humor</strong> sie auch vor dem Burnout-<br />
Syndrom schützt.<br />
Die vielen Langzeitpatienten in unseren Kinderkliniken und insbesondere auf den Kinder-Krebsstationen bedürfen dringend<br />
humorvoller Therapeuten. Kinder erleben das Krankenhaus mit seiner Apparate-Medizin als befremdend, belastend und<br />
bedrohlich.<br />
In solcher sterilen und anti-emotionalen Klinikatmosphäre verlieren manche Kinder die Fähigkeit zum Spielen. Damit haben<br />
sie keine Möglichkeit mehr, ihre Besorgnisse und Ängste spielerisch zu verarbeiten. Um ihre innere Not zu wenden, ist es<br />
notwendig, dass sie wieder spielen lernen.<br />
Wer könnte da besser helfen als der Clown oder die Clownesse? Im Gewande von «Clown-Doktoren» oder «Lachärzten»<br />
bringen sie mit ihren «Clown-Visiten» ein wenig Fröhlichkeit in die Krankenzimmer. Dabei dauert es meist nicht lang, bis<br />
die kleinen Patienten sich freudig in das fröhliche Clownspiel einbeziehen lassen.<br />
Schon allein die Clown-Requisiten in Form quietschender Reflexhämmer, übergroßer Fieberthermometer und Ulkspritzen<br />
rufen bei den Kindern herzhaftes Lachen hervor. Das trifft auch für die skurrilen Diagnosen und lustigen<br />
Therapieanweisungen, z.B. dreimal täglich Kakaoeinläufe oder -transfusionen zu.<br />
Vor notwendigen Eingriffen wird die Operation mit großem Trara und unter großzügiger Verwendung von Toilettenrollen als<br />
Verbandszeug an Puppen oder Plüschtieren mit Hilfe der Kinder spielerisch vollzogen. Das lindert ihre Erwartungsängste<br />
und stärkt ihre Hoffnung auf Heilung.<br />
Untersuchungen an krebskranken Kindern haben gezeigt, dass sie sich nach den Clownbesuchen wesentlich besser fühlten<br />
und sich auf die nächste Clownvisite freuten (Meincke u. a. 1997). Die Kinder halten dabei förmlich Ausschau nach spaßigen<br />
Ereignissen. Sie spüren instinktiv, dass sie <strong>Humor</strong> und Lachen zum Überleben brauchen.<br />
Wenn ein Kind sich gerade über einen lustigen Zaubertrick einer Clownin gefreut hat, wird das «Glückshormon» Endorphin<br />
ausgeschüttet, das nachweislich auch die Schmerzen mindert. Wenn man bedenkt, dass in Deutschland jährlich 1 1/2<br />
Millionen Kinder ins Krankenhaus kommen, dann leuchtet ein, welchen hohen Stellenwert das «Lachen auf Rezept» vor<br />
allem in unseren Kinderkliniken hat (vgl. Heeck 1997 und Kiphard 1998).<br />
Lächeln und Lachen als Gefühlsausdruck<br />
Schon Babys gebrauchen instinktiv das Lächeln in enger Korrespondenz mit der Mutter als Medium des emotionalen<br />
Austauschs. Als soziales Phänomen signalisiert Lächeln Offenheit und Kontaktbereitschaft. Es schlägt die Brücke vom Ich<br />
zum Du. Man kann sein Lächeln anderen schenken. Und selbst im Umgang mit Fremden löst ein Lächeln Spannungen auf,<br />
«entwaffnet» den Partner und hemmt Aggressionen.<br />
Während das spontane soziale Lächeln schon im Alter von nur wenigen Wochen auftritt, kann man das Lachen erst etwa ab<br />
vier Monaten beobachten. Es entsteht, wenn die Mutter das Baby liebevoll «knuddelt» und dabei lustige Geräusche von sich<br />
gibt. Erst mit einem Jahr kommt es zu Lachreaktionen aufgrund komischer Ereignisse und die Norm verletzender<br />
Handlungen. Wenn beispielsweise die Mutter aus Spaß am Fläschchen saugt oder die Zunge rausstreckt, so reizt dies zum<br />
Lachen.<br />
Lachen ist willentlich nicht steuerbar, es geschieht einfach reflexhaft. Einmal ausgelöst, macht es sich selbständig. Jeder<br />
Versuch, das eigene Lachen zu unterdrücken, ist von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Mir ist eine solche Situation aus<br />
meiner Kindheit in Erinnerung.<br />
Während des täglichen Mittagessens, das mein gestrenger Vater zu einem Ritual machte, bekam ich plötzlich einen<br />
regelrechten Lachanfall. Klar, dass ich sofort hinausgeworfen wurde mit der Weisung, wieder hereinzukommen, wenn ich<br />
wieder «vernünftig» sei. Ich nahm mich wirklich zusammen. Aber jedes Mal, wenn ich das Esszimmer betrat und in das<br />
ernste und würdevolle Gesicht meines Vaters blickte, prustete ich erneut los. Das Lachen hatte von mir Besitz ergriffen.<br />
Im ausgelassenen Lachen kann der Unterdrückte endlich «Dampf ablassen“. Lachen wirkt hier wie eine Befreiung. Gerade<br />
der behinderte Mensch wendet sich im Lachen gegen alle im Leben erduldeten Zurücksetzungen, Verletzungen und<br />
Ungerechtigkeiten. Lachen bedeutet aber auch den Sieg über die eigene Furcht vor allem Autoritären und «Heiligen“. Indem<br />
der lachende Mensch sich über alle Zwänge und Tabus hinwegsetzt, rebelliert er gegen alles Starre und Verbotene. Insofern<br />
ist im Lachen auch etwas Aggressives verborgen; zumindest dient es der Selbstverteidigung.<br />
Derartige befreiende Grenzüberschreitungen durch ein exzessives Sich-Ausschütten vor Lachen bewirken immer auch eine<br />
erhöhte Ausatmung. Deshalb ist das Lachen, außer dem Singen, eine hervorragende natürliche Atemübung. Schade, dass das<br />
tägliche Lachen nicht auf dem Stundenplan steht!<br />
Die Lachforschung, Gelotologie genannt (von griech.: gelos, das Lachen), hat sich intensiv mit den positiven körperlichen<br />
Veränderungen befasst, die durch intensives Lachen ausgelöst werden. So erhöht sich nach Untersuchungen von Berk (1994,<br />
1996) der Adrenalin- und Noradrenalspiegel im Blut und wirkt damit entzündungshemmend.<br />
Außerdem vermehren sich die Immunglobulin-Antikörper, was eine bessere Immunabwehr zur Folge hat. Und last but not<br />
least sorgt der schon erwähnte Endorphinspiegel dafür, dass der «homo ridens“, der lachende Mensch sich gut fühlt und<br />
vermehrte Lebensfreude empfindet.<br />
Freude als Lebensbereicherung<br />
Marianne Frostig (1973, 1978) wie auch Verena Kast (1991, 1998) stellen mit Bedauern fest, dass die Freude als das<br />
positivste menschliche Gefühl in der Psychologie wie auch generell in der Therapie zu kurz kommt. Dabei ist das Erwecken<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 21/68