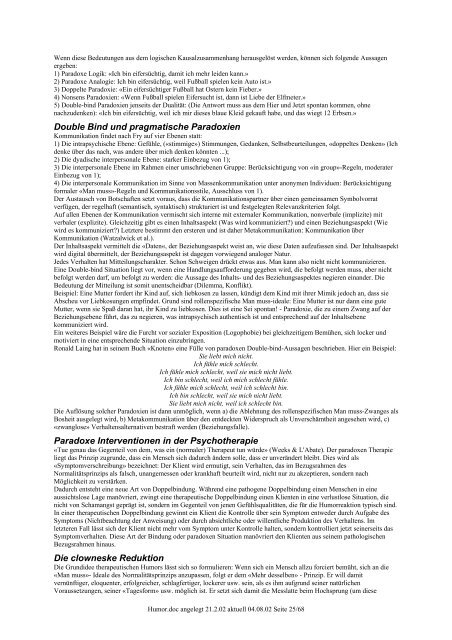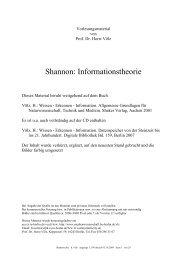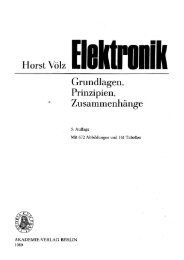Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wenn diese Bedeutungen aus dem logischen Kausalzusammenhang herausgelöst werden, können sich folgende Aussagen<br />
ergeben:<br />
1) Paradoxe Logik: «Ich bin eifersüchtig, damit ich mehr leiden kann.»<br />
2) Paradoxe Analogie: Ich bin eifersüchtig, weil Fußball spielen kein Auto ist.»<br />
3) Doppelte Paradoxie: «Ein eifersüchtiger Fußball hat Ostern kein Fieber.»<br />
4) Nonsens Paradoxien: «Wenn Fußball spielen Eifersucht ist, dann ist Liebe der Elfmeter.»<br />
5) Double-bind Paradoxien jenseits der Dualität: (Die Antwort muss aus dem Hier und Jetzt spontan kommen, ohne<br />
nachzudenken): «Ich bin eifersüchtig, weil ich mir dieses blaue Kleid gekauft habe, und das wiegt 12 Erbsen.»<br />
Double Bind und pragmatische Paradoxien<br />
Kommunikation findet nach Fry auf vier Ebenen statt:<br />
1) Die intrapsychische Ebene: Gefühle, («stimmige») Stimmungen, Gedanken, Selbstbeurteilungen, «doppeltes Denken» (Ich<br />
denke über das nach, was andere über mich denken könnten ...);<br />
2) Die dyadische interpersonale Ebene: starker Einbezug von 1);<br />
3) Die interpersonale Ebene im Rahmen einer umschriebenen Gruppe: Berücksichtigung von «in group»-Regeln, moderater<br />
Einbezug von 1);<br />
4) Die interpersonale Kommunikation im Sinne von Massenkommunikation unter anonymen Individuen: Berücksichtigung<br />
formaler «Man muss»-Regeln und Kommunikationsstile, Ausschluss von 1).<br />
Der Austausch von Botschaften setzt voraus, dass die Kommunikationspartner über einen gemeinsamen Symbolvorrat<br />
verfügen, der regelhaft (semantisch, syntaktisch) strukturiert ist und festgelegten Relevanzkriterien folgt.<br />
Auf allen Ebenen der Kommunikation vermischt sich interne mit externaler Kommunikation, nonverbale (implizite) mit<br />
verbaler (explizite). Gleichzeitig gibt es einen Inhaltsaspekt (Was wird kommuniziert?) und einen Beziehungsaspekt (Wie<br />
wird es kommuniziert?) Letztere bestimmt den ersteren und ist daher Metakommunikation: Kommunikation über<br />
Kommunikation (Watzalwick et al.).<br />
Der Inhaltsaspekt vermittelt die «Daten«, der Beziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aufzufassen sind. Der Inhaltsaspekt<br />
wird digital übermittelt, der Beziehungsaspekt ist dagegen vorwiegend analoger Natur.<br />
Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter. Schon Schweigen drückt etwas aus. Man kann also nicht nicht kommunizieren.<br />
Eine Double-bind Situation liegt vor, wenn eine Handlungsaufforderung gegeben wird, die befolgt werden muss, aber nicht<br />
befolgt werden darf, um befolgt zu werden: die Aussage des Inhalts- und des Beziehungsaspektes negieren einander. Die<br />
Bedeutung der Mitteilung ist somit unentscheidbar (Dilemma, Konflikt).<br />
Beispiel: Eine Mutter fordert ihr Kind auf, sich liebkosen zu lassen, kündigt dem Kind mit ihrer Mimik jedoch an, dass sie<br />
Abscheu vor Liebkosungen empfindet. Grund sind rollenspezifische Man muss-ideale: Eine Mutter ist nur dann eine gute<br />
Mutter, wenn sie Spaß daran hat, ihr Kind zu liebkosen. Dies ist eine Sei spontan! - Paradoxie, die zu einem Zwang auf der<br />
Beziehungsebene führt, das zu negieren, was intrapsychisch authentisch ist und entsprechend auf der Inhaltsebene<br />
kommuniziert wird.<br />
Ein weiteres Beispiel wäre die Furcht vor sozialer Exposition (Logophobie) bei gleichzeitigem Bemühen, sich locker und<br />
motiviert in eine entsprechende Situation einzubringen.<br />
Ronald Laing hat in seinem Buch «Knoten» eine Fülle von paradoxen Double-bind-Aussagen beschrieben. Hier ein Beispiel:<br />
Sie liebt mich nicht.<br />
Ich fühle mich schlecht.<br />
Ich fühle mich schlecht, weil sie mich nicht liebt.<br />
Ich bin schlecht, weil ich mich schlecht fühle.<br />
Ich fühle mich schlecht, weil ich schlecht bin.<br />
Ich bin schlecht, weil sie mich nicht liebt.<br />
Sie liebt mich nicht, weil ich schlecht bin.<br />
Die Auflösung solcher Paradoxien ist dann unmöglich, wenn a) die Ablehnung des rollenspezifischen Man muss-Zwanges als<br />
Bosheit ausgelegt wird, b) Metakommunikation über den entdeckten Widerspruch als Unverschämtheit angesehen wird, c)<br />
«zwanglose» Verhaltensalternativen bestraft werden (Beziehungsfalle).<br />
Paradoxe Interventionen in der Psychotherapie<br />
«Tue genau das Gegenteil von dem, was ein (normaler) Therapeut tun würde» (Weeks & L'Abate). Der paradoxen Therapie<br />
liegt das Prinzip zugrunde, dass ein Mensch sich dadurch ändern solle, dass er unverändert bleibt. Dies wird als<br />
«Symptomverschreibung» bezeichnet: Der Klient wird ermutigt, sein Verhalten, das im Bezugsrahmen des<br />
Normalitätsprinzips als falsch, unangemessen oder krankhaft beurteilt wird, nicht nur zu akzeptieren, sondern nach<br />
Möglichkeit zu verstärken.<br />
Dadurch entsteht eine neue Art von Doppelbindung. Während eine pathogene Doppelbindung einen Menschen in eine<br />
aussichtslose Lage manövriert, zwingt eine therapeutische Doppelbindung einen Klienten in eine verlustlose Situation, die<br />
nicht von Schamangst geprägt ist, sondern im Gegenteil von jenen Gefühlsqualitäten, die für die <strong>Humor</strong>reaktion typisch sind.<br />
In einer therapeutischen Doppelbindung gewinnt ein Klient die Kontrolle über sein Symptom entweder durch Aufgabe des<br />
Symptoms (Nichtbeachtung der Anweisung) oder durch absichtliche oder willentliche Produktion des Verhaltens. Im<br />
letzteren Fall lässt sich der Klient nicht mehr vom Symptom unter Kontrolle halten, sondern kontrolliert jetzt seinerseits das<br />
Symptomverhalten. Diese Art der Bindung oder paradoxen Situation manövriert den Klienten aus seinem pathologischen<br />
Bezugsrahmen hinaus.<br />
Die clowneske Reduktion<br />
Die Grundidee therapeutischen <strong>Humor</strong>s lässt sich so formulieren: Wenn sich ein Mensch allzu forciert bemüht, sich an die<br />
«Man muss»- Ideale des Normalitätsprinzips anzupassen, folgt er dem «Mehr desselben» - Prinzip. Er will damit<br />
vernünftiger, eloquenter, erfolgreicher, schlagfertiger, lockerer usw. sein, als es ihm aufgrund seiner natürlichen<br />
Voraussetzungen, seiner «Tagesform» usw. möglich ist. Er setzt sich damit die Messlatte beim Hochsprung (um diese<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 25/68