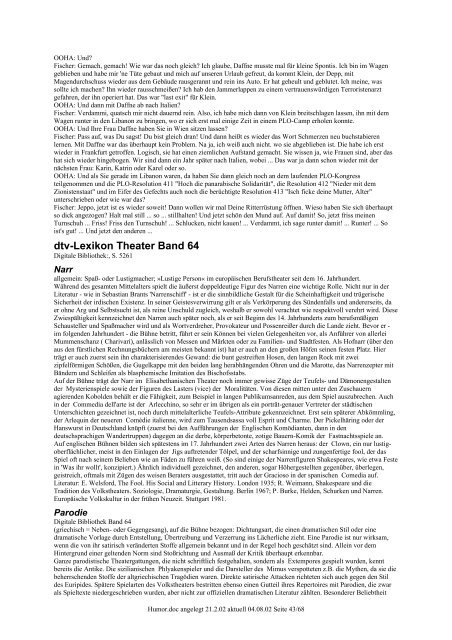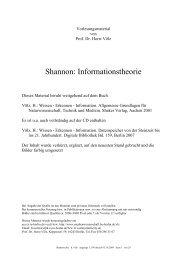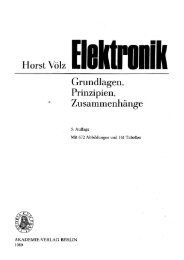Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
OOHA: Und?<br />
Fischer: Gemach, gemach! Wie war das noch gleich? Ich glaube, Daffne musste mal für kleine Spontis. Ich bin im Wagen<br />
geblieben und habe mir 'ne Tüte gebaut und mich auf unseren Urlaub gefreut, da kommt Klein, der Depp, mit<br />
Magendurchschuss wieder aus dem Gebäude rausgerannt und rein ins Auto. Er hat geheult und geblutet. Ich meine, was<br />
sollte ich machen? Ihn wieder rausschmeißen? Ich hab den Jammerlappen zu einem vertrauenswürdigen Terroristenarzt<br />
gefahren, der ihn operiert hat. Das war "last exit" für Klein.<br />
OOHA: Und dann mit Daffne ab nach Italien?<br />
Fischer: Verdammi, quatsch mir nicht dauernd rein. Also, ich habe mich dann von Klein breitschlagen lassen, ihn mit dem<br />
Wagen runter in den Libanon zu bringen, wo er sich erst mal einige Zeit in einem PLO-Camp erholen konnte.<br />
OOHA: Und Ihre Frau Daffne haben Sie in Wien sitzen lassen?<br />
Fischer: Pass auf, was Du sagst! Du bist gleich dran! Und dann heißt es wieder das Wort Schmerzen neu buchstabieren<br />
lernen. Mit Daffne war das überhaupt kein Problem. Na ja, ich weiß auch nicht. wo sie abgeblieben ist. Die habe ich erst<br />
wieder in Frankfurt getroffen. Logisch, sie hat einen ziemlichen Aufstand gemacht. Sie wissen ja, wie Frauen sind, aber das<br />
hat sich wieder hingebogen. Wir sind dann ein Jahr später nach Italien, wobei ... Das war ja dann schon wieder mit der<br />
nächsten Frau: Karin, Katrin oder Karel oder so.<br />
OOHA: Und als Sie gerade im Libanon waren, da haben Sie dann gleich noch an dem laufenden PLO-Kongress<br />
teilgenommen und die PLO-Resolution 411 "Hoch die panarabische Solidarität", die Resolution 412 "Nieder mit dem<br />
Zionistenstaat" und im Eifer des Gefechts auch noch die berüchtigte Resolution 413 "Isch ficke deine Mutter, Alter"<br />
unterschrieben oder wie war das?<br />
Fischer: Jeppo, jetzt ist es wieder soweit! Dann wollen wir mal Deine Ritterrüstung öffnen. Wieso haben Sie sich überhaupt<br />
so dick angezogen? Halt mal still ... so ... stillhalten! Und jetzt schön den Mund auf. Auf damit! So, jetzt friss meinen<br />
Turnschuh ... Friss! Friss den Turnschuh! ... Schlucken, nicht kauen! ... Verdammt, ich sage runter damit! ... Runter! ... So<br />
ist's gut! ... Und jetzt den anderen ...<br />
dtv-Lexikon Theater Band 64<br />
Digitale Bibliothek:, S. 5261<br />
Narr<br />
allgemein: Spaß- oder Lustigmacher; »Lustige Person« im europäischen Berufstheater seit dem 16. Jahrhundert.<br />
Während des gesamten Mittelalters spielt die äußerst doppeldeutige Figur des Narren eine wichtige Rolle. Nicht nur in der<br />
Literatur - wie in Sebastian Brants 'Narrenschiff' - ist er die sinnbildliche Gestalt für die Scheinhaftigkeit und trügerische<br />
Sicherheit der irdischen Existenz. In seiner Geistesverwirrung gilt er als Verkörperung des Sündenfalls und andererseits, da<br />
er ohne Arg und Selbstsucht ist, als reine Unschuld zugleich, weshalb er sowohl verachtet wie respektvoll verehrt wird. Diese<br />
Zwiespältigkeit kennzeichnet den Narren auch später noch, als er seit Beginn des 14. Jahrhunderts zum berufsmäßigen<br />
Schausteller und Spaßmacher wird und als Wortverdreher, Provokateur und Possenreißer durch die Lande zieht. Bevor er -<br />
im folgenden Jahrhundert - die Bühne betritt, führt er sein Können bei vielen Gelegenheiten vor, als Anführer von allerlei<br />
Mummenschanz ( Charivari), anlässlich von Messen und Märkten oder zu Familien- und Stadtfesten. Als Hofnarr (über den<br />
aus den fürstlichen Rechnungsbüchern am meisten bekannt ist) hat er auch an den großen Höfen seinen festen Platz. Hier<br />
trägt er auch zuerst sein ihn charakterisierendes Gewand: die bunt gestreiften Hosen, den langen Rock mit zwei<br />
zipfelförmigen Schößen, die Gugelkappe mit den beiden lang herabhängenden Ohren und die Marotte, das Narrenzepter mit<br />
Bändern und Schleifen als blasphemische Imitation des Bischofsstabs.<br />
Auf der Bühne trägt der Narr im Elisabethanischen Theater noch immer gewisse Züge der Teufels- und Dämonengestalten<br />
der Mysterienspiele sowie der Figuren des Lasters (vice) der Moralitäten. Von diesen mitten unter den Zuschauern<br />
agierenden Kobolden behält er die Fähigkeit, zum Beispiel in langen Publikumsanreden, aus dem Spiel auszubrechen. Auch<br />
in der Commedia dell'arte ist der Arlecchino, so sehr er im übrigen als ein porträt-genauer Vertreter der städtischen<br />
Unterschichten gezeichnet ist, noch durch mittelalterliche Teufels-Attribute gekennzeichnet. Erst sein späterer Abkömmling,<br />
der Arlequin der neueren Comédie italienne, wird zum Tausendsassa voll Esprit und Charme. Der Pickelhäring oder der<br />
Hanswurst in Deutschland knüpft (zuerst bei den Aufführungen der Englischen Komödianten, dann in den<br />
deutschsprachigen Wandertruppen) dagegen an die derbe, körperbetonte, zotige Bauern-Komik der Fastnachtsspiele an.<br />
Auf englischen Bühnen bilden sich spätestens im 17. Jahrhundert zwei Arten des Narren heraus: der Clown, ein nur lustigoberflächlicher,<br />
meist in den Einlagen der Jigs auftretender Tölpel, und der scharfsinnige und zungenfertige fool, der das<br />
Spiel oft nach seinem Belieben wie an Fäden zu führen weiß. (So sind einige der Narrenfiguren Shakespeares, wie etwa Feste<br />
in 'Was ihr wollt', konzipiert.) Ähnlich individuell gezeichnet, den anderen, sogar Höhergestellten gegenüber, überlegen,<br />
geistreich, oftmals mit Zügen des weisen Beraters ausgestattet, tritt auch der Gracioso in der spanischen Comedia auf.<br />
Literatur: E. Welsford, The Fool. His Social and Litterary History. London 1935; R. Weimann, Shakespeare und die<br />
Tradition des Volkstheaters. Soziologie, <strong>Dr</strong>amaturgie, Gestaltung. Berlin 1967; P. Burke, Helden, Schurken und Narren.<br />
Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit. Stuttgart 1981.<br />
Parodie<br />
Digitale Bibliothek Band 64<br />
(griechisch = Neben- oder Gegengesang), auf die Bühne bezogen: Dichtungsart, die einen dramatischen Stil oder eine<br />
dramatische Vorlage durch Entstellung, Übertreibung und Verzerrung ins Lächerliche zieht. Eine Parodie ist nur wirksam,<br />
wenn die von ihr satirisch veränderten Stoffe allgemein bekannt und in der Regel hoch geschätzt sind. Allein vor dem<br />
Hintergrund einer geltenden Norm sind Stoßrichtung und Ausmaß der Kritik überhaupt erkennbar.<br />
Ganze parodistische Theatergattungen, die nicht schriftlich festgehalten, sondern als Extempores gespielt wurden, kennt<br />
bereits die Antike. Die sizilianischen Phlyakenspieler und die Darsteller des Mimus verspotteten z.B. die Mythen, da sie die<br />
beherrschenden Stoffe der altgriechischen Tragödien waren. Direkte satirische Attacken richteten sich auch gegen den Stil<br />
des Euripides. Spätere Spielarten des Volkstheaters bestritten ebenso einen Gutteil ihres Repertoires mit Parodien, die zwar<br />
als Spieltexte niedergeschrieben wurden, aber nicht zur offiziellen dramatischen Literatur zählten. Besonderer Beliebtheit<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 43/68