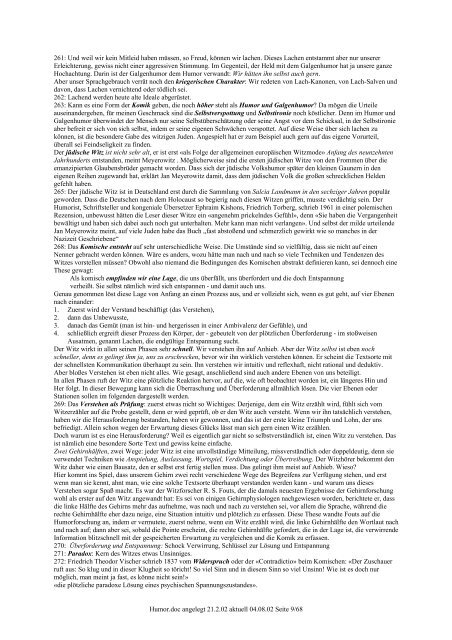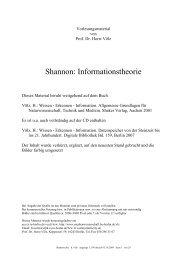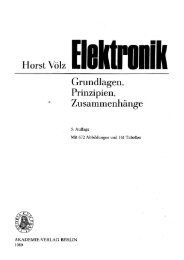Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Humor - Prof. Dr. Horst Völz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
261: Und weil wir kein Mitleid haben müssen, so Freud, können wir lachen. Dieses Lachen entstammt aber nur unserer<br />
Erleichterung, gewiss nicht einer aggressiven Stimmung. Im Gegenteil, der Held mit dem Galgenhumor hat ja unsere ganze<br />
Hochachtung. Darin ist der Galgenhumor dem <strong>Humor</strong> verwandt: Wir hätten ihn selbst auch gern.<br />
Aber unser Sprachgebrauch verrät noch den kriegerischen Charakter: Wir redeten von Lach-Kanonen, von Lach-Salven und<br />
davon, dass Lachen vernichtend oder tödlich sei.<br />
262: Lachend werden heute alte Ideale abgerüstet.<br />
263: Kann es eine Form der Komik geben, die noch höher steht als <strong>Humor</strong> und Galgenhumor? Da mögen die Urteile<br />
auseinandergehen, für meinen Geschmack sind die Selbstverspottung und Selbstironie noch köstlicher. Denn im <strong>Humor</strong> und<br />
Galgenhumor überwindet der Mensch nur seine Selbstüberschätzung oder seine Angst vor dem Schicksal, in der Selbstironie<br />
aber befreit er sich von sich selbst, indem er seine eigenen Schwächen verspottet. Auf diese Weise über sich lachen zu<br />
können, ist die besondere Gabe des witzigen Juden. Angespielt hat er zum Beispiel auch gern auf das eigene Vorurteil,<br />
überall sei Feindseligkeit zu finden.<br />
Der jüdische Witz ist nicht sehr alt, er ist erst «als Folge der allgemeinen europäischen Witzmode» Anfang des neunzehnten<br />
Jahrhunderts entstanden, meint Meyerowitz . Möglicherweise sind die ersten jüdischen Witze von den Frommen über die<br />
emanzipierten Glaubensbrüder gemacht worden. Dass sich der jüdische Volkshumor später den kleinen Gaunern in den<br />
eigenen Reihen zugewandt hat, erklärt Jan Meyerowitz damit, dass dem jüdischen Volk die großen schrecklichen Helden<br />
gefehlt haben.<br />
265: Der jüdische Witz ist in Deutschland erst durch die Sammlung von Salcia Landmann in den sechziger Jahren populär<br />
geworden. Dass die Deutschen nach dem Holocaust so begierig nach diesen Witzen griffen, musste verdächtig sein. Der<br />
<strong>Humor</strong>ist, Schriftsteller und kongeniale Übersetzer Ephraim Kishons, Friedrich Torberg, schrieb 1961 in einer polemischen<br />
Rezension, unbewusst hätten die Leser dieser Witze ein «angenehm prickelndes Gefühl», denn «Sie haben die Vergangenheit<br />
bewältigt und haben sich dabei auch noch gut unterhalten. Mehr kann man nicht verlangen». Und selbst der milde urteilende<br />
Jan Meyerowitz meint, auf viele Juden habe das Buch „fast abstoßend und schmerzlich gewirkt wie so manches in der<br />
Nazizeit Geschriebene“<br />
268: Das Komische entsteht auf sehr unterschiedliche Weise. Die Umstände sind so vielfältig, dass sie nicht auf einen<br />
Nenner gebracht werden können. Wäre es anders, wozu hätte man nach und nach so viele Techniken und Tendenzen des<br />
Witzes vorstellen müssen? Obwohl also niemand die Bedingungen des Komischen abstrakt definieren kann, sei dennoch eine<br />
These gewagt:<br />
Als komisch empfinden wir eine Lage, die uns überfällt, uns überfordert und die doch Entspannung<br />
verheißt. Sie selbst nämlich wird sich entspannen - und damit auch uns.<br />
Genau genommen löst diese Lage von Anfang an einen Prozess aus, und er vollzieht sich, wenn es gut geht, auf vier Ebenen<br />
nach einander:<br />
1. Zuerst wird der Verstand beschäftigt (das Verstehen),<br />
2. dann das Unbewusste,<br />
3. danach das Gemüt (man ist hin- und hergerissen in einer Ambivalenz der Gefühle), und<br />
4. schließlich ergreift dieser Prozess den Körper, der - gebeutelt von der plötzlichen Überforderung - im stoßweisen<br />
Ausatmen, genannt Lachen, die endgültige Entspannung sucht.<br />
Der Witz wirkt in allen seinen Phasen sehr schnell. Wir verstehen ihn auf Anhieb. Aber der Witz selbst ist eben noch<br />
schneller, denn es gelingt ihm ja, uns zu erschrecken, bevor wir ihn wirklich verstehen können. Er scheint die Textsorte mit<br />
der schnellsten Kommunikation überhaupt zu sein. Ihn verstehen wir intuitiv und reflexhaft, nicht rational und deduktiv.<br />
Aber bloßes Verstehen ist eben nicht alles. Wie gesagt, anschließend sind auch andere Ebenen von uns beteiligt.<br />
In allen Phasen ruft der Witz eine plötzliche Reaktion hervor, auf die, wie oft beobachtet worden ist, ein längeres Hin und<br />
Her folgt. In dieser Bewegung kann sich die Überraschung und Überforderung allmählich lösen. Die vier Ebenen oder<br />
Stationen sollen im folgenden dargestellt werden.<br />
269: Das Verstehen als Prüfung: zuerst etwas nicht so Wichtiges: Derjenige, dem ein Witz erzählt wird, fühlt sich vom<br />
Witzerzähler auf die Probe gestellt, denn er wird geprüft, ob er den Witz auch versteht. Wenn wir ihn tatsächlich verstehen,<br />
haben wir die Herausforderung bestanden, haben wir gewonnen, und das ist der erste kleine Triumph und Lohn, der uns<br />
befriedigt. Allein schon wegen der Erwartung dieses Glücks lässt man sich gern einen Witz erzählen.<br />
Doch warum ist es eine Herausforderung? Weil es eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, einen Witz zu verstehen. Das<br />
ist nämlich eine besondere Sorte Text und gewiss keine einfache.<br />
Zwei Gehirnhälften, zwei Wege: jeder Witz ist eine unvollständige Mitteilung, missverständlich oder doppeldeutig, denn sie<br />
verwendet Techniken wie Anspielung, Auslassung, Wortspiel, Verdichtung oder Übertreibung. Der Witzhörer bekommt den<br />
Witz daher wie einen Bausatz, den er selbst erst fertig stellen muss. Das gelingt ihm meist auf Anhieb. Wieso?<br />
Hier kommt ins Spiel, dass unserem Gehirn zwei recht verschiedene Wege des Begreifens zur Verfügung stehen, und erst<br />
wenn man sie kennt, ahnt man, wie eine solche Textsorte überhaupt verstanden werden kann - und warum uns dieses<br />
Verstehen sogar Spaß macht. Es war der Witzforscher R. S. Fouts, der die damals neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung<br />
wohl als erster auf den Witz angewandt hat: Es sei von einigen Gehirnphysiologen nachgewiesen worden, berichtete er, dass<br />
die linke Hälfte des Gehirns mehr das aufnehme, was nach und nach zu verstehen sei, vor allem die Sprache, während die<br />
rechte Gehirnhälfte eher dazu neige, eine Situation intuitiv und plötzlich zu erfassen. Diese These wandte Fouts auf die<br />
<strong>Humor</strong>forschung an, indem er vermutete, zuerst nehme, wenn ein Witz erzählt wird, die linke Gehirnhälfte den Wortlaut nach<br />
und nach auf; dann aber sei, sobald die Pointe erscheint, die rechte Gehirnhälfte gefordert, die in der Lage ist, die verwirrende<br />
Information blitzschnell mit der gespeicherten Erwartung zu vergleichen und die Komik zu erfassen.<br />
270: Überforderung und Entspannung: Schock Verwirrung, Schlüssel zur Lösung und Entspannung<br />
271: Paradox: Kern des Witzes etwas Unsinniges.<br />
272: Friedrich Theodor Vischer schrieb 1837 vom Widerspruch oder der «Contradictio» beim Komischen: «Der Zuschauer<br />
ruft aus: So klug und in dieser Klugheit so töricht! So viel Sinn und in diesem Sinn so viel Unsinn! Wie ist es doch nur<br />
möglich, man meint ja fast, es könne nicht sein!»<br />
«die plötzliche paradoxe Lösung eines psychischen Spannungszustandes».<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 9/68