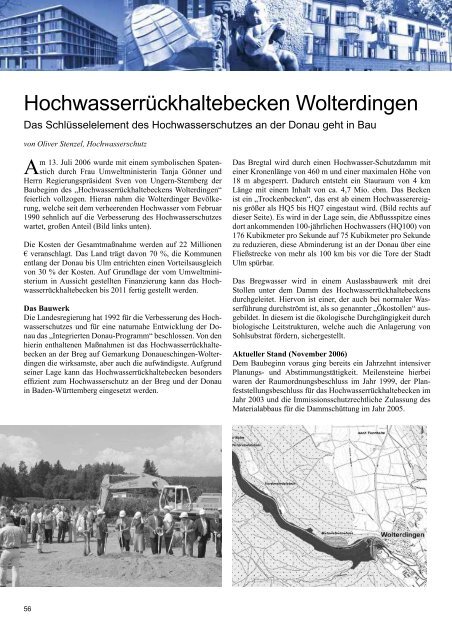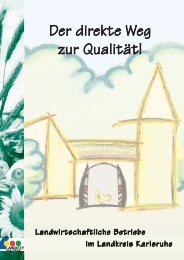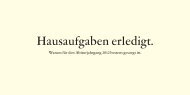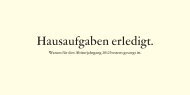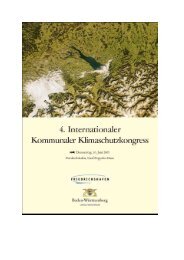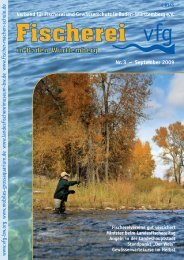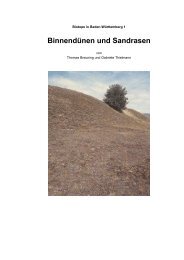Vollbildanzeige - BOA - Baden-Württembergisches Online-Archiv
Vollbildanzeige - BOA - Baden-Württembergisches Online-Archiv
Vollbildanzeige - BOA - Baden-Württembergisches Online-Archiv
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen<br />
<br />
von Oliver Stenzel, Hochwasserschutz<br />
Am 13. Juli 2006 wurde mit einem symbolischen Spatenstich<br />
durch Frau Umweltministerin Tanja Gönner und<br />
Herrn Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg der<br />
Baubeginn des „Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen“<br />
feierlich vollzogen. Hieran nahm die Wolterdinger Bevölkerung,<br />
welche seit dem verheerenden Hochwasser vom Februar<br />
1990 sehnlich auf die Verbesserung des Hochwasserschutzes<br />
wartet, großen Anteil (Bild links unten).<br />
Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden auf 22 Millionen<br />
<br />
entlang der Donau bis Ulm entrichten einen Vorteilsausgleich<br />
von 30 % der Kosten. Auf Grundlage der vom Umweltministerium<br />
in Aussicht gestellten Finanzierung kann das Hochwasserrückhaltebecken<br />
bis 2011 fertig gestellt werden.<br />
Das Bauwerk<br />
Die Landesregierung hat 1992 für die Verbesserung des Hochwasserschutzes<br />
und für eine naturnahe Entwicklung der Donau<br />
das „Integrierten Donau-Programm“ beschlossen. Von den<br />
hierin enthaltenen Maßnahmen ist das Hochwasserrückhaltebecken<br />
an der Breg auf Gemarkung Donaueschingen-Wolterdingen<br />
die wirksamste, aber auch die aufwändigste. Aufgrund<br />
seiner Lage kann das Hochwasserrückhaltebecken besonders<br />
<br />
in <strong>Baden</strong>-Württemberg eingesetzt werden.<br />
Das Bregtal wird durch einen Hochwasser-Schutzdamm mit<br />
einer Kronenlänge von 460 m und einer maximalen Höhe von<br />
18 m abgesperrt. Dadurch entsteht ein Stauraum von 4 km<br />
Länge mit einem Inhalt von ca. 4,7 Mio. cbm. Das Becken<br />
ist ein „Trockenbecken“, das erst ab einem Hochwasserereignis<br />
größer als HQ5 bis HQ7 eingestaut wird. (Bild rechts auf<br />
<br />
dort ankommenden 100-jährlichen Hochwassers (HQ100) von<br />
176 Kubikmeter pro Sekunde auf 75 Kubikmeter pro Sekunde<br />
zu reduzieren, diese Abminderung ist an der Donau über eine<br />
Fließstrecke von mehr als 100 km bis vor die Tore der Stadt<br />
Ulm spürbar.<br />
Das Bregwasser wird in einem Auslassbauwerk mit drei<br />
Stollen unter dem Damm des Hochwasserrückhaltebeckens<br />
durchgeleitet. Hiervon ist einer, der auch bei normaler Wasserführung<br />
durchströmt ist, als so genannter „Ökostollen“ ausgebildet.<br />
In diesem ist die ökologische Durchgängigkeit durch<br />
biologische Leitstrukturen, welche auch die Anlagerung von<br />
Sohlsubstrat fördern, sichergestellt.<br />
<br />
Dem Baubeginn voraus ging bereits ein Jahrzehnt intensiver<br />
Planungs- und Abstimmungstätigkeit. Meilensteine hierbei<br />
waren der Raumordnungsbeschluss im Jahr 1999, der Planfeststellungsbeschluss<br />
für das Hochwasserrückhaltebecken im<br />
Jahr 2003 und die Immissionsschutzrechtliche Zulassung des<br />
Materialabbaus für die Dammschüttung im Jahr 2005.<br />
56