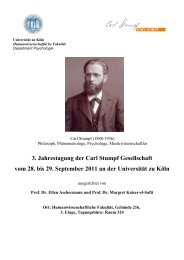Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Margret Kaiser-el-Safti 13<br />
Schönheit der organischen Welt als Zeichen für einen gütigen Gott werten<br />
wollen. Anscheinend erachtete Kant es als eine Schmähung Gottes, sinnliche<br />
Schönheit und Güte anstelle göttlicher Allmacht und Allwissenheit als Zeichen<br />
des Göttlichen zu würdigen. In „Der einzig mögliche Beweisgrund Gottes“ steht<br />
der Begriff des physikalisch-mathematischen Unendlichen im Zentrum; hier<br />
bricht Kant geradezu in Entzücken aus, um mathematischer und physikalischer<br />
Gesetzmäßigkeit ästhetische Qualitäten abzugewinnen respektive plausibel zu<br />
machen. Als Beispiele, die evident machen sollen, wie „in einem ungeheuren<br />
Mannigfaltigen Zusammenpassung und Einheit herrsche“ (1763/1968, Bd. 2, S.<br />
655), nannte Kant die „Einrichtungen des Zirkels“ und das „Gesetz der<br />
Schwere“, die in ihrer universellen Anwendbarkeit „das Gefühl auf eine<br />
ähnliche oder erhabenere Art wie die zufälligen Schönheiten der Natur rühren“<br />
(S. 657). Kant bezeichnet hier die pure Anschauung des unendlichen Raumes als<br />
„ästhetisch“: „Die Bezeichnung des Unendlichen ist gleichwohl schön und<br />
eigentlich ästhetisch“ (ebd., S. 728).<br />
Man findet später in der „Kritik der reinen Vernunft“ mit der neuerlichen<br />
Reduzierung des Ästhetischen auf die „reinen“ Formen Raum und Zeit mit<br />
Abstrich sinnlicher Qualitäten und einer strikten Absage an die Möglichkeit<br />
einer ästhetischen Wissenschaft (im Sinne einer Lehre vom Kunst- und<br />
Naturschönen), aber nun auch (in kritischer Perspektive) mit einer<br />
grundsätzlichen Verneinung der Möglichkeit von Gottesbeweisen und der<br />
prinzipiellen Zurückweisung einer wissenschaftlich relevanten Beantwortung<br />
der Frage, wie in dem Mannigfaltigen Zusammenhang, Gestalt und Einheit<br />
herrschen könnte, nichts mehr von der mathematischen Auffassung des Schönen<br />
wieder – mit Ausnahme der angeblich unendlichen Raumanschauung; ansonsten<br />
ist alles, was an ein qualitatives oder künstlerisches Ästhetisches appellieren<br />
könnte, zu diesem Zeitpunkt radikal ausgemerzt worden, weil es nach Kant eine<br />
Wissenschaft von Kunstdingen oder der Kunst schlechterdings gar nicht geben<br />
kann und eine „transzendentale Ästhetik“ jetzt nur noch allgemeine oder<br />
elementare Bedingungen der Wahrnehmungslehre behandeln soll (vgl. Kants<br />
lange Fußnote in der KrV, B 36).<br />
Selbst in der zuletzt verfassten dritten „Kritik“ Kants, der „Kritik der<br />
Urteilskraft“, die sowohl hinsichtlich der Anschauung des Weltganzen als auch<br />
bezüglich einer Verständigung über das Schöne in der Kunst gewisse, wenngleich<br />
immer noch nicht wissenschaftlich verwendbare Revisionen erkennen<br />
lässt, wird das Qualitative oder werden die sinnlichen Inhalte von Kunstwerken,<br />
nämlich Farben und Töne, im Vergleich mit der reinen Form diskreditiert: In der<br />
Malerei erlange nur die Form, die Zeichnung, nicht jedoch die Farbe, Bedeutung.<br />
Was die Musik anbelangt, will Kant ihr überhaupt keinen künstlerischen<br />
Wert beimessen. Als reine Sinnenkunst und „Sprache der Affekte“ appelliere sie<br />
nur an die Nerven und verhelfe zu keiner Kultivierung; als rein transitorisches,<br />
dem Zeitverlauf unterworfenes flüchtiges Phänomen, entbehre sie jeglicher