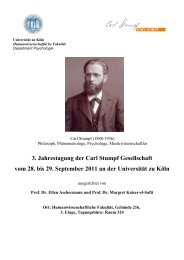Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Margret Kaiser-el-Safti 24<br />
einzugehen sein wird, die Richtung von Herbart ausgehend weiterverfolgt und<br />
beide Weisen der Wahrnehmung, das Sehen und das Hören, nach dem<br />
neuesten Wissensstand für die Erkenntnis berücksichtigt werden? Indem<br />
Herbart das sinnlich Gegebene der Erscheinungen zur Grundlage seiner<br />
Erkenntnistheorie erklärte, lag es fast nahe, dass er auf Gestaltgesetze der<br />
Wahrnehmung stoßen musste. Tatsächlich lassen sich diese, wie bereits<br />
angedeutet, auch ausfindig machen, wenngleich ein Rest von Fragwürdigkeit<br />
zurückbleibt.<br />
Es ist falsch oder doch zu pauschal geurteilt, Herbart sei zu den<br />
Elementaristen und Assoziationisten zu zählen (vgl. in diesem Sinne Sachs-<br />
Hombach 2004, S. 217); Herbarts Synechologie verweigert sich dem<br />
Atomismus; die seelischen Realen sollen als unausgedehnte Punkte<br />
(psychische Monaden) vorgestellt werden, nicht als Atome, und es empfiehlt<br />
sich, ,Elemente„ im Sinne des Atomismus und im Sinne des Kontinuums<br />
(unausgedehnte Punkte oder Grenzen) zu unterscheiden. Selbst die<br />
Bezeichnung „Mechanik der Vorstellungen“ lässt nicht pauschal auf einen<br />
naturwissenschaftlich verblendeten Vertreter des Mechanismus schließen.<br />
Herbart spricht sehr wohl von Akten des Vorstellens; seine Ästhetik der<br />
Verhältnisse und seine Urteilslehre widersprechen ohnehin einer derartigen<br />
Stigmatisierung. Dennoch scheint die Frage, wie wir die Formen wahrnehmen<br />
und wie letzten Endes ein „vollendetes Vorstellen“ im Rahmen einer<br />
„Mechanik und Dynamik der Vorstellungen“, nicht definitiv, sondern nur<br />
,apagogisch„ beantwortet worden zu sein, nämlich nicht so, wie Kant sich die<br />
Formwahrnehmung zurechtgelegt hatte, weil nach Kants Prämissen für das<br />
Problem, wie die Geistseele ausgedehnt Körperliches wahrzunehmen<br />
vermöchte, in der Tat keine Lösung gefunden werden konnte.<br />
Herbart bleibt letztlich eine restlos überzeugende Antwort schuldig, weil er<br />
in einem entscheidenden Punkt bei Kant stehen bleibt, indem er dem<br />
Psychischen selbst keine ,Extension‘ im Sinne der Ganzheit appliziert, dafür<br />
aber den Raum als „intelligiblen Raum“ definiert respektive Raum und Zeit so<br />
einander annähert, dass Unterscheidendes quasi entfällt. Herbart deutet auf<br />
eine Verwendung der Begriffe, die sich günstig auf die moderne Physik, aber<br />
nicht auf die Phänomenologie und Psychologie ausgewirkt hat, indem er vom<br />
„Zeitraum“ spricht (vgl. SW Bd. 9, S. 117). Das mag zu der Auffassung von<br />
,Zeit als vierte Dimension des Raumes„ inspiriert haben, wird aber nicht der<br />
Phänomenologie des Sehens noch der des Hörens gerecht. Herbarts Annäherung<br />
von Zeit an Raum und vive versa steht eng in Zusammenhang mit<br />
Herbarts Metaphysik der unausgedehnten Seele, mit der Herbart der Lehre<br />
Kants verbunden bleibt und evozierte psychologisch die weit verbreitete<br />
falsche Auffassung, um Ausgedehntes wahrzunehmen, müsste entweder das<br />
Auge oder (bei blinden Menschen) die Hand vorwärts und rückwärts bewegt