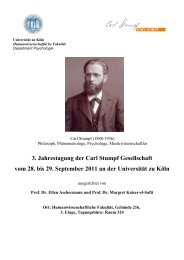Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Margret Kaiser-el-Safti 17<br />
die Herbart anstelle zahlreicher, beliebig zu eruierender Seelenvermögen<br />
durchzusetzen suchte, weil ,Seelenvermögen„ die Psychologie in eine<br />
„Mythologie“ zurückverwandelten, kann nur andeutungsweise Bezug genommen<br />
werden. Herbarts Votum für die Erneuerung der rationalen Psychologie<br />
macht eine aufschlussreiche- und folgenreiche Bemerkung über Kants grundsätzlichen<br />
Irrtum:<br />
Er [Kant] verwechselte das Ich, welches das Behältnis unserer sämtlichen<br />
Vorstellungen zu sein scheint, indem wir sie alle uns zuschreiben, – mit der<br />
Durchdringung dieser Vorstellungen untereinander, vermöge derer sie<br />
verschmelzen oder einander verdunkeln, sich gegenseitig als größer und kleiner,<br />
als ähnlich und unähnlich bestimmen. Hier liegt die Einheit der Komplexion, um<br />
deretwillen eine einzige Substanz für alle anzunehmen ist; jenes Ich, welches nur<br />
als Subjekt des Denkens, und nicht als Prädikat gedacht werden kann, ist dabei<br />
überflüssig (zit. nach Henckmann 1993, S. 284).<br />
Kant hatte das empirische Ich mit der Seele zusammenfallen, das transzendentale<br />
Ich als reine Form definiert und aus beiden die Unmöglichkeit einer<br />
wissenschaftlichen Psychologie hergeleitet. Herbart unterscheidet den metaphysischen<br />
Seelenbegriff vom empirischen Ichbegriff; wenn er für Durchdringung<br />
und Verschmelzung der Vorstellungen votiert, geschieht dies vor dem Hintergrund<br />
der Synechologie, Herbarts Lehre von Raum, Zeit und Materie als etwas<br />
ursprünglich Zusammenhängendes und Stetiges. Diese Lehre ist sowohl Grundlage<br />
für Herbarts Seelenmodell als auch zentraler Kritikpunkt an Kants transzendentaler<br />
Elementarlehre, besonders der transzendentalen Ästhetik. Zunächst soll<br />
kurz auf das Seelenmodell eingegangen, anschließend Herbarts Kritik der<br />
„transzendentalen Ästhetik“ noch etwas näher ins Auge gefasst werden.<br />
Die im ersten Band der Hauptwerkes dargestellte „Statik und Dynamik“ der<br />
Vorstellungen als die einzigen psychischen Elemente konkretisiert Herbarts<br />
Versuch, den Grundwiderspruch im Ichbegriff der idealistischen Philosophie<br />
aufzulösen: Herbart will einerseits die Widersprüche im Ich der idealistischen<br />
Philosophie aufdecken, das sich selbst sowohl zum Subjekt als auch zum Objekt<br />
zu machen vermag und sich infolge dieser Zweideutigkeit in einen infiniten<br />
Regress verliert; er moniert andererseits als die größte Schwäche des Idealismus<br />
dessen fiktionale Ausrichtung, aus dem omnipotenten transzendentalen Subjekt<br />
die Welt als das Nicht-Ich aus dem Ich heraus- und hervortreten zu lassen und<br />
ihm gegenüberzustellen. Dagegen verweist Herbart auf die grammatische Form<br />
des Ich und insistiert darauf, dass dem Ich nicht die Welt gegenüberstünde,<br />
sondern das Du und das Wir begegneten (vgl. SW Bd.6, S. 168 ff.). Während der<br />
Seele Unveränderlichkeit attribuiert wird, betrachtet Herbart das Ich als ein dem<br />
Wechselspiel von Vorstellungstätigkeit, sprachlich-kommunikativer und körperlicher<br />
Entwicklung unterworfenes, als ein bis ins Alter veränderliches