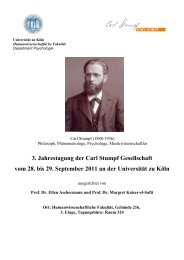Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Margret Kaiser-el-Safti 16<br />
Intervalle. Hume erklärt die Fiktion, die es unserer Phantasie erlaube, über das<br />
Wirkliche hinaus vorzustellen oder zu denken, das heißt in der einmal<br />
eingeschlagen Richtung fortzufahren, als eine natürliche Eigenschaft unserer<br />
geistigen Aktivität. Es lohnt sich, den ganzen Passus zu zitieren, weil er in einer<br />
Weise die Grenze zwischen Empirie und Apriorismus markiert, die für Herbarts<br />
Verständnis von Ästhetik und Ethik relevant ist:<br />
Ein Musiker, der findet, dass sein Gehör jeden Tag feiner wird, und dem es<br />
gelingt, sich selbst durch Nachdenken und Aufmerksamkeit zu korrigieren, führt<br />
in Gedanken einen psychischen Prozeß weiter, auch wenn sein Gegenstand ihn im<br />
Stiche läßt; er gewinnt so schließlich den Begriff einer vollkommenen Terz und<br />
Oktave, ohne daß er imstande wäre, zu sagen, woher er den Maßstab dafür nimmt.<br />
Dieselbe Fiktion vollzieht der Maler in bezug auf Farben, der Mechaniker in<br />
bezug auf Bewegungen. (1748/I973, I. Buch, S. 68)<br />
Wenn Herbart denselben Tatbestand des vollendeten Vorstellens durch die<br />
Phantasie, die konsonanten Intervalle betreffend, auf eine Ebene mit Kants<br />
„synthetischen Urteilen a priori“ platzierte, darf dieser Vergleich nicht wörtlich<br />
genommen (Herbart war ein Gegner erfahrungsvorgängiger Postulate) und muss<br />
als der Versuch gewertet werden, der Bedeutung der konsonanten Intervalle und<br />
Akkorde nicht nur für das gesamte europäische Musiksystem, sondern als<br />
paradigmatische Gesetzesgrundlage dem Ästhetischen und Psychologischen<br />
schlechthin Nachdruck zu verleihen.<br />
Nur die Musik, keine andere Kunst, liefert laut Herbart überhaupt ästhetische<br />
Gesetzmäßigkeiten, die jedoch infolge der philosophisch notorischen Unterschätzung<br />
der Musik nicht anerkannt werden:<br />
Leider sind genau bestimmte ästhetische Urtheile unsern Aesthetikern so neu und<br />
fremd, daß sie an die Möglichkeit derselben nicht glauben wollen; daß sie nicht<br />
begreifen, wie der ästhetische Sand ein vestes Getriebe solle tragen können. Ich<br />
habe daran erinnert, dass seit Jahrhunderten das Gebäude der Musik auf den<br />
ästhetischen Bestimmungen der Tonverhältnisse unerschüttert steht. Aber man<br />
kennt die Musik nur aus den Erholungsstunden. (SW Bd. 3, S. 116-17).<br />
b) Der ganze erste „synthetische“ Band der Herbartschen „Psychologie als<br />
Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik“<br />
(1824-25) ist sowohl der Auseinandersetzung mit Kants Verwerfung der<br />
rationalen Psychologie, der Kritik des Ichbegriffs und der konstruktivistischen<br />
Grundlage in der Philosophie Kants und Fichtes gewidmet, als auch der Versuch<br />
gemacht wird, auf der Basis einer Hypothese Attribute einer unausgedehnten<br />
Seelensubstanz zu verteidigen, auf die hier nur am Rande eingegangen werden<br />
kann. Auf Herbarts umstrittene Metaphysik seelischer Realen in Anlehnung an<br />
Leibniz„ Monadenlehre wird hier aus Platzgründen weitgehend verzichtet, und<br />
auch auf Herbarts Seelenmodell einer „Statik und Dynamik der Vorstellungen“,