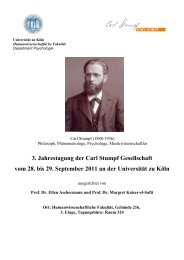Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Margret Kaiser-el-Safti 9<br />
in der Tat eine besondere Rolle spielte und gerade in diesem Kontext auch als<br />
bedeutender ,Vorläufer„ der Gestaltpsychologie zu würdigen ist, wie weiter<br />
unter zu erhärten sein wird. Was die Nahtstelle zwischen einem neuen<br />
Seelenbegriff im Rahmen gestaltpsychologischer Ansätze und der akustischmusikalischen<br />
Wahrnehmung anbelangt, ist der historische Rekurs auf Herbart<br />
unverzichtbar.<br />
1. 3. Johann Friedrich Herbart als Pionier der wissenschaftlichen<br />
Psychologie in Deutschland<br />
Während Herbart heute noch von pädagogischer Seite gewürdigt wird, geriet in<br />
Deutschland in Vergessenheit, was er für die wissenschaftliche Psychologie<br />
geleistet hatte (vgl. dazu Kaiser-el-Safti 2001; 2009; 2010); dass Herbart als<br />
Philosoph in Deutschland nicht gewürdigt wird (vgl. dazu Heesch 1999),<br />
begünstigte die Haltung, die subtilen Schwierigkeiten der Kantischen „transzendentalen<br />
Ästhetik“ gar nicht erst zur Diskussion gelangen zu lassen, und<br />
beispielsweise eine Arbeit, wie die von Ulrich Sonnemann „Zeit ist<br />
Anhörungsform Über Wesen und Wirken einer kantischen Verkennung des<br />
Ohrs“ (1983) zu ignorieren oder zu relativieren (vgl. dazu Eidam 2007, S. 211<br />
f.). Sonnemann greift eine Thematik auf, die bereits einen zentralen Punkt in<br />
Herbarts Kantkritik ausmachte, die sich allerdings nicht allein auf eine Kritik der<br />
„transzendentalen Ästhetik“ begrenzte, sondern sich auch auf Kants Logik und<br />
Ethik (insbesondere die Kantische Willens- und Freiheitslehre) erstreckte.<br />
Herbart scheint mit seiner Kantkritik den im 19. Jahrhundert tonangebenden<br />
Neukantianismus aller erst ins Leben gerufen zu haben, der sich einerseits zu<br />
profilieren vermochte, weil er von Herbarts Kritik an Hegel, Schelling und<br />
Fichte profitierte und andererseits Herbart als Gegner namhaft machen und zur<br />
eigenen Profilierung benutzen konnte. Insbesondere der Marburger Neukantianer<br />
Paul Natorp verfolgte eine Strategie, die Herbart als Pädagogen zu würdigen<br />
vorgab, aber als Philosoph mit einer an Beleidigung grenzenden Polemik zu<br />
diskreditieren suchte, weil Herbart die Ethik Kants durch eine Psychologie der<br />
Moral zu ersetzen suchte (vgl. Natorp 1898). Allerdings hatte Herbart sich schon<br />
früh ablehnend über die Freiheitslehre Kants geäußert (in 1806 SW Bd. 1, S. 259<br />
ff.). Eine Pädagogik auf der Basis einer psychologisch fundierten Ästhetik statt<br />
auf religiöse oder auf die metaphysischen Fundamente des „kategorischen Imperativs“<br />
zu gründen, galt als ein Vergehen an der größten deutschen philosophischen<br />
Autorität. Hier interessiert aber vornehmlich die Kritik an Kants metaphysischen<br />
und erkenntnistheoretischen Prämissen. Sowohl Ethik als Erkenntnistheorie<br />
betreffend empfahl Herbart:<br />
Wir wollen unseren Geist kennen lernen, wie er wirklich ist, und wir halten uns<br />
weit entfernt von idealistischen Träumen, wie wir ihn gern haben möchten, wenn<br />
wir uns selbst beliebig machen und einrichten könnten. (SW Bd. 6, S. 130)