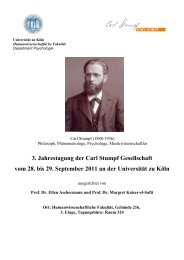Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Margret Kaiser-el-Safti 36<br />
seines Lehrers, <strong>Stumpf</strong> zu Grabe trägt, um einzig den Komplexbegriff – als<br />
gänzlich voraussetzungslos bezüglich unerweisbarer metaphysischer Theorien<br />
über die Zeit und unbewiesener logischer Theorien über das Urteilen (als Akt) –<br />
durchzusetzen (ausführlicher dazu Kaiser-el-Safti 2001, S. 373 f.).<br />
Schumann eliminiert demnach die schwierigsten Fragen aus der Gestalttheorie,<br />
die nach der Zeitwahrnehmung (Sukzession und Gleichzeitigkeit) und<br />
die nach dem Wesen des Urteils als auffassende aktive Tätigkeit und sucht nach<br />
einem Grund- oder Urphänomen, das frei zu halten sei von erkenntnistheoretischen,<br />
logisch-begrifflichen und strukturanalytischen Voraussetzungen:<br />
den puren Komplex.<br />
Hans Cornelius deutete in seinem Beitrag „Über Gestaltqualitäten“ (1900, S.<br />
100 ff.) an, dass Schumann in seiner Kritik an der Grazer Produktionstheorie<br />
gewissermaßen übersehen hätte, dass er, Cornelius, doch bereits die gleichen<br />
grundlegenden Einwände wie Elias Müller (Schumanns Lehrer) von der Basis<br />
einer rein empiristischen („positiv empirischen“) Grundlage gegen die<br />
Verwendung von (metaphysisch zu deutender?) seelischer Produktivität oder<br />
psychischen Akten formuliert hätte; ob er damit ein Plagiat Schumanns andeuten<br />
wollte, sei dahingestellt. Für die alleinige Berücksichtigung von Inhalten hatte<br />
allerdings schon zehn Jahre zuvor der Neukantianer Paul Natorp gegen die<br />
Brentanoschule plädiert, weil eine auf beziehende Akte aufbauende Psychologie<br />
(Brentanos Intentionalitätslehre) nicht empirische Psychologie, sondern<br />
„Metaphysik“ und „Mythologie“ betreibe (1888, S. 19). Davon unangefochten<br />
führte <strong>Stumpf</strong> 1907 nochmals aus, dass nach seinem Verständnis von<br />
empirischer Psychologie sowohl die Inhaltsseite des Psychischen als auch die<br />
der psychischen Funktionen (Akte) zu berücksichtigen sei (vgl. <strong>Stumpf</strong> 1907 d,<br />
dazu Kaiser-el-Safti 2010 b).<br />
Unter Schumanns Ägide in Frankfurt/Main gelang Max Wertheimer mit dem<br />
sogenannten Phi-Phänomen (das von Schumann gesuchte Urphänomen der<br />
Komplextheorie?) der Durchbruch der neuen Gestalttheorie auf visueller Basis.<br />
Über die erkenntnistheoretische Relevanz dieser ,Entdeckung„ ist wohl das letzte<br />
Wort noch nicht gesprochen. <strong>Stumpf</strong> bezog in der „Erkenntnislehre“ ausführlich<br />
zu Wertheimers Untersuchungen und der These Stellung, es handle sich beim<br />
Phi-Phänomen um etwas rein Qualitatives, um ein Bewegungsphänomen, das<br />
nicht identisch sei mit einer Lageveränderung des Objekts, eine Bewegung ohne<br />
Bewegtes (vgl. <strong>Stumpf</strong> (2011, S. 297). Wertheimer lege Wert darauf, schreibt<br />
<strong>Stumpf</strong>, dass das fragliche Phänomen unter den Gestaltbegriff falle; nach<br />
<strong>Stumpf</strong> gibt es aber keine Gestalten, „an denen keinerlei <strong>Teil</strong>e in irgendeinem<br />
Sinne unterschieden werden können“ (301). Wertheimers Erklärung, es handle<br />
sich um einen Gehirnmechanismus, den er mit dem Ausdruck „Kurzschluss“<br />
oder „Querfunktion“ kennzeichnete, bietet nach <strong>Stumpf</strong> keine Erklärung,<br />
sondern „eben nur eine bequeme Formel“ an (302). Auch der amerikanische<br />
Philosoph Nelson Goodman zweifelt unter Berufung auf die gründlichen