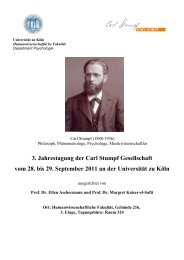Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Margret Kaiser-el-Safti 42<br />
intensiven Forschens wiederum mit der Analyse des Substanzbegriffs (vgl. dazu<br />
auch Paul Elvers„ Beitrag in diesem Band). Wollte man dem mereologischen<br />
Ansatz <strong>Stumpf</strong>s gerechter werden als dies in dieser kurzen Darstellung<br />
geschehen kann, müsste nicht nur der innere Zusammenhang der Gestaltwahrnehmung<br />
mit dem Substanzbegriff stets gewärtig sein, sondern auch<br />
<strong>Stumpf</strong>s Analysen weiterer wissenschaftsfundierender Grundbegriffe (Kategorien)<br />
wie „Ähnlichkeit“, „Gleichheit“, „Kausalität“, „Notwenigkeit“ in der<br />
„Erkenntnislehre“ (vgl. 2011, S. 84 ff.) respektive deren logische und deskriptivsensorische<br />
Relevanz mit reflektiert werden. Aber wenngleich die Komplexität<br />
der Gestaltwahrnehmung in der Tat als Anfang und als Kern der Forschungsintention<br />
<strong>Stumpf</strong>s angesehen werden kann, bildete sein eigentliches Erkenntnisziel<br />
eine weit über die Ähnlichkeitsassoziation hinausgehende allgemeine<br />
Relationslehre, die sowohl Natur- als auch Geisteswissenschaft einer beide<br />
verbindenden logisch und methodologisch vertretbaren Konzeption zu<br />
unterstellen suchte (vgl. dazu <strong>Stumpf</strong>s Akademiearbeit von 1907 „Zur<br />
Einteilung der Wissenschaften“). In diesem Lichte scheint ,Gestalt„ definitorisch<br />
sowohl perzeptorische und logische Strukturen (Gebilde, Inhalte) als auch<br />
psychische Urteilsakte miteinander zu verbinden respektive psychische Prozesse<br />
– wie beispielsweise Vergleichen, Analyse und Synthese, diskursive und<br />
intuitive Verfahrensweisen – nachweisen und begrifflich klären zu wollen, die<br />
sowohl im Kognitiven (Logisch-Mathematischen) als auch im Sensorischen zur<br />
Anwendung gelangen.<br />
3. Konzeption einer allgemeinen Verhältnislehre<br />
Entgegen der konstruktivistischen und rationalistischen Erkenntnistheorie (der<br />
„kopernikanischen Wende“) Immanuel Kants postuliert <strong>Stumpf</strong> die Wahrnehmung<br />
von Verhältnissen: „Nicht das Bewußtsein ‚stiftet„ Beziehungen<br />
zwischen unseren Empfindungen [wie Kant behauptet hatte], sondern sie sind<br />
dem Bewußtsein gegeben, es hat sie nur zu konstatieren“ (S. 222). Für<br />
Musikalische bestehe „gerade im Erfassen und Verfolgen dieser inneren<br />
Beziehungen einer der Hauptreize der Musik, wenn auch nicht der tiefste“ (S.<br />
222). „Verhältniswahrnehmungen sind aufs engste in die Sinneswahrnehmung<br />
verflochten“. Als Beispiele für Grundverhältnisse nennt <strong>Stumpf</strong> die abgestufte<br />
Ähnlichkeit zweier Empfindungsinhalte (Töne) und definiert „Gleichheit“ im<br />
Sinnesgebiet als „extreme Ähnlichkeit“ (in logisch-mathematischen Kontexten<br />
hat „Gleichheit“ eine andere Bedeutung, nämlich „gleich“ in Bezug auf die<br />
jeweilige Gattung). Demnach beruht Reihenbildung von Empfindungen, wie die<br />
Anordnung aller Töne in einer Reihe von den tiefsten bis zu den höchsten, auf<br />
abgestufter Ähnlichkeit; die graduell abgestufte Verschmelzung gleichzeitiger<br />
Töne (die Intervallverwandtschaft) gilt aber ebenfalls als eine phänomenologische<br />
Grundtatsache, die besonders im Bereich der Töne auffällig ist.