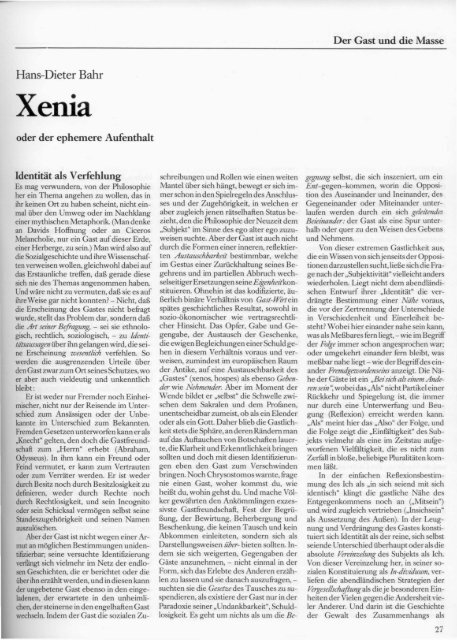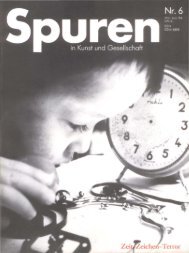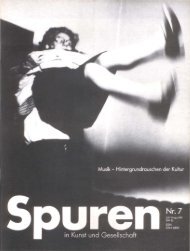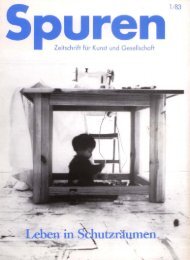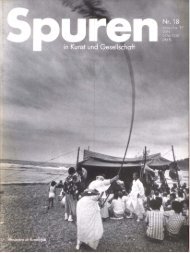Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Gast und die Masse<br />
Hans-Dieter Bahr<br />
Xenia<br />
oder der ephemere Aufenthalt<br />
Identität als Verfehlung<br />
Es mag veiWUndern, von der Philosophie<br />
her ein Thema angehen zu wollen, das in<br />
ihr keinen Ort zu haben scheint, nicht einmal<br />
über den Umweg oder im Nachklang<br />
einer mythischen Metaphorik. (Man denke<br />
an Davids Hoffuung oder an Ciceros<br />
Melancholie, nur ein Gast auf dieser Erde,<br />
einer Herberge, zu sein.) Man wird also auf<br />
die Sozialgeschichte und ihre Wissenschaften<br />
verweisen wollen, gleichwohl dabei auf<br />
das Erstaunliche treffen, daß gerade diese<br />
sich nie des Themas angenommen haben.<br />
Und wäre nicht zu vermuten, daß sie es auf<br />
ihre Weise gar nicht konnten?- Nicht, daß<br />
die Erscheinung des Gastes nicht befragt<br />
wurde, stellt das Problem dar, sondern daß<br />
die Art seiner Brfragung, - sei sie ethnologisch,<br />
rechtlich, soziologisch, - zu Identz~<br />
tiitsaussagen über ihn gelangen wird, die seine<br />
Erscheinung wesentlich verfehlen. So<br />
werden die ausgrenzenden Urteile über<br />
den Gast zwar zum Ort seines Schutzes, wo<br />
er aber auch vieldeutig und unkenntlich<br />
bleibt:<br />
Er ist weder nur Fremder noch Einheimischer,<br />
nicht nur der Reisende im Unterschied<br />
zum Ansässigen oder der Unbekannte<br />
im Unterschied zum Bekannten.<br />
Fremden Gesetzen unterworfen kann er als<br />
"Knecht" gelten, den doch die Gastfreundschaft<br />
zum "Herrn" erhebt (Abraham,<br />
Odysseus). In ihm kann ein Freund oder<br />
Feind vermutet, er kann zum Vertrauten<br />
oder zum Verräter werden. Er ist weder<br />
durch Besitz noch durch Besitzlosigkeit zu<br />
definieren, weder durch Rechte noch<br />
durch Rechtlosigkeit, und sein Incognito<br />
oder sein Schicksal vermögen selbst seine<br />
Standeszugehörigkeit und seinen amen<br />
auszulöschen.<br />
Aber der Gast ist nicht wegen einer Armut<br />
an möglichen Bestimmungen unidentifizierbar;<br />
seine versuchte Identifizierung<br />
verHingt sich vielmehr im Netz der endlosen<br />
Geschichten, die er berichtet oder die<br />
über ihn erzählt werden, und in diesen kann<br />
der ungebetene Gast ebenso in den eingeladenen,<br />
der erwartete in den unheimlichen,<br />
der steinerne in den engelhaften Gast<br />
wechseln. Indem der Gast die sozialen Zu-<br />
Schreibungen und Rollen wie einen weiten<br />
Mantel über sich hängt, bewegt er sich immer<br />
schon in den Spielregeln des Anschlusses<br />
und der Zugehörigkeit, in welchen er<br />
aber zugleich jenen rätselhaften Status bezieht,<br />
den die Philosophie der euzeit dem<br />
"Subjekt" im Sinne des ego alter ego zuzuweisen<br />
suchte. Aber der Gast ist auch nicht<br />
durch die Formen einer inneren, reflektierten<br />
Austauschbarkeil bestimmbar, welche<br />
im Gestus einer Zurückhaltung seines Begehrens<br />
und im partiellen Abbruch wechselseitiger<br />
Ersetzungen seine E~enh ezikon <br />
stituieren. Ohnehin ist das kodifizierte, äußerlich<br />
binäre Verhältnis von Gast-Wirtein<br />
spätes geschichtliches Resultat, sowohl in<br />
sozio-ökonomischer wie vertragsrechtlicher<br />
Hinsicht. Das Opfer, Gabe und Gegengabe,<br />
der Austausch der Geschenke,<br />
die ewigen Begleichungen einer Schuld gehen<br />
in diesem Verhältnis voraus und verweisen,<br />
zumindest im europäischen Raum<br />
der Antike, auf eine Austauschbarkeit des<br />
"Gastes" (xenos, hospes) als ebenso Gebender<br />
wie Nehmender. Aber im Moment der<br />
Wende bildet er "selbst" die Schwelle zwischen<br />
dem Sakralen und dem Profanen,<br />
unentscheidbar zumeist, ob als ein Elender<br />
oder als ein Gott. Daher blieb die Gastlichkeit<br />
stets die Sphäre, an deren Rändern man<br />
auf das Auftauchen von Botschaften lauerte,<br />
die Klarheit und Erkenntlichkeit bringen<br />
sollten und doch mit diesen Identifizierungen<br />
eben den Gast zum Verschwinden<br />
bringen. Noch Chrysostomos warnte, frage<br />
nie einen Gast, woher kommst du, wie<br />
heißt du, wohin gehst du. Und mache Völker<br />
gewährten den Ankömmlingen exzessivste<br />
Gastfreundschaft, Fest der Begrüßung,<br />
der Bewirtung, Beherbergung und<br />
Beschenkung, die keinen Tausch und kein<br />
Abkommen einleiteten, sondern sich als<br />
Darstellungsweisen über- bieten sollten. Indem<br />
sie sich weigerten, Gegengaben der<br />
Gäste anzunehmen, - nicht einmal in der<br />
Form, sich das Erlebte des Anderen erzählen<br />
zu lassen und sie danach auszufragen, <br />
suchten sie die Gesetze des Tausches zu suspendieren,<br />
als existiere der Gast nur in der<br />
Paradoxie seiner "Undankbarkeit", Schuldlosigkeit.<br />
Es geht um nichts als um die Be-<br />
gegnung selbst, die sich inszeniert, um ein<br />
Ent-gegen-kommen, worin die Opposition<br />
des Auseinander und Ineinander, des<br />
Gegeneinander oder Miteinander unterlaufen<br />
werden durch ein sich geledendes<br />
Beiet'nander: der Gast als eine <strong>Spur</strong> unterhalb<br />
oder quer zu den Weisen des Gebens<br />
und Nehmens.<br />
Von dieser extremen Gastlichkeit aus,<br />
die ein Wissen von sich jenseits der Oppositionen<br />
darzustellen sucht, ließe sich die Frage<br />
nach der "Subjektivität" vielleicht anders<br />
wiederholen. Liegt nicht dem abendländischen<br />
Entwurf ihrer "Identität" die verdrängte<br />
Bestimmung einer Ntihe voraus,<br />
die vor der Zertrennung der Unterschiede<br />
in Verschiedenheit und Einerleiheit besteht?<br />
Wobei hier einander nahe sein kann,<br />
was als Meßbares fern liegt,- wie im Begriff<br />
der Folge immer schon angesprochen war;<br />
oder umgekehrt einander fern bleibt, was<br />
meßbar nahe liegt- wie der Begriff des einander<br />
Fremdgewordenseins anzeigt. Die ä<br />
he der Gäste ist ein "Bei sich als einem Anderen<br />
set'n ': wobei das "Als" nicht Partikel einer<br />
Rückkehr und Spiegelung ist, die immer<br />
nur durch eine Unterwerfung und Beugung<br />
(Reflexion) erreicht werden kann.<br />
"Als" meint hier das "Also" der Folge, und<br />
die Folge zeigt die "Einfaltigkeit" des Subjekts<br />
vielmehr als eine im Zeitstau aufgeworfenen<br />
Vielfaltigkeit, die es nicht zum<br />
Zerfall in bloße, beliebige Pluralitäten kommen<br />
läßt.<br />
In der einfachen Reflexionsbestimmung<br />
des Ich als "in sich seiend mit sich<br />
identisch" klingt die gastliche ähe des<br />
Entgegenkommens noch an ("Mitsein")<br />
und. wird zugleich vertrieben (",nsichsein"<br />
als Aussetzung des Außen). In der Leugnung<br />
und Verdrängung des Gastes konstituiert<br />
sich Identität als der reine, sich selbst<br />
seiende Unterschied überhaupt oder als die<br />
absolute Vereinzelung des Subjekts als Ich.<br />
Von dieser Vereinzelung her, in seiner sozialen<br />
Konstituierung als In-dividuum, verliefen<br />
die abendländischen Strategien der<br />
Vergesellschtifiung als die je besonderen Einheiten<br />
der Vielen gegen die Andersheit vieler<br />
Anderer. Und darin ist die Geschichte<br />
der Gewalt des Zusammenhangs als<br />
27