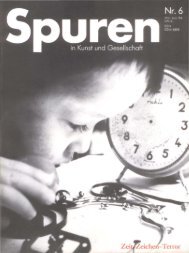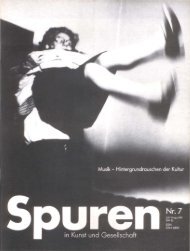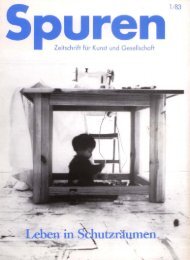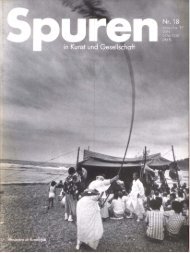Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zwang Offenheit. Gründlicher konnten die<br />
wegweisend gedachten und sicherlich<br />
auch bequemen Eindeutigkeiten aus der<br />
Geschichte der Medienzentren und der Videoarbeit<br />
nicht abgeschaffi: werden. Vorbei<br />
ist es mit der guten alten Zeit, wo die Videomacher<br />
sich berufen fuhlten, den anderen<br />
zu sagen, wo's längs ging. Video ex stellt<br />
sich in den freien Raum oder aufs freie Feld,<br />
um zuzuhören und zuzusehen und um auszuprobieren<br />
und sich einzulassen auf das,<br />
was sich dem Begreifen noch entzieht. Die<br />
Installationen waren schiere Gegenwart,<br />
und das Konzept (Münzenberg-)Negt-Kluge<br />
der siebziger Jahre, Video als mediales<br />
Hilfsmittel zur Durchsetzung gesellschaftlicher<br />
Gegenmacht zu gebrauchen, erledigte<br />
Geschichte: "Frontberichterstattung"<br />
(Video-ex).<br />
Auch die Funktion der Medienzentren<br />
der frühen achtziger Jahre, sich Betroffenen<br />
als Service zur Vernetzung eigener Erfahrungen<br />
anzubieten, erschien auf dieser<br />
Werkschau nur noch als historischer (und<br />
erfolgloser) Versuch, dem Video eine nützliche<br />
Aufgabe zuzuweisen. Das Medienzentrum<br />
Die Thede, bekannt durch eine<br />
Anzahl Hausbesetzervideos, stellte Anfang<br />
der achtziger Jahre schnelle Gegenöffentlichkeit<br />
her, was "zu diesem Zeitpunkt richtig<br />
war" (Christian Bau). "Die hektische<br />
Vorgehensweise war aber nicht durchzuhalten."<br />
Die Thede hat jetzt den Anspruch,<br />
Zusammenhänge sinnlich darzustellen<br />
("Aus Lust am Schauen") und statt "Oberflächenphänomene"<br />
eigene und fremde Erfahrungen<br />
zu registrieren, nämlich hinzuhören<br />
und hinzusehen. Auch hier hat das<br />
Video die zentrale Rolle verloren, Inhalte<br />
zu transportieren. Stattdessen verhilft der<br />
sichtliche Spaß und der Stolz, ein Werk herzustellen<br />
(nämlich innerhalb eines Mediums<br />
zu arbeiten), den Filmen und Videos<br />
zu neuer Überzeugungskraft. "Wir haben<br />
Lust, Bilder zu machen, Töne aufZunehmen,<br />
Filme zu gestalten." (Die Motte) Die<br />
Video-Collage der Motte, "Sperrmüll", ist<br />
daher mehr als Zielgruppenfilm und Stadtteilkulturmanifest,<br />
nämlich: Fest und Ereignis.<br />
FastzwanzigJahre vorher war es der<br />
Kurzfilm "Anfangszeiten", der eine Radfah-<br />
56<br />
rer-Werbe-Fahrt fur den Super-Scope<br />
Spielfilm "Der heimliche Kuß" zum Ereignis<br />
machte. Zu den funf radfahrenden<br />
Kunststudenten der Filmklasse Wolfgang<br />
Rambsbott (<strong>Hamburg</strong>) gehörte Holger<br />
Meins, der fur den politischen Kampf später<br />
auf das Medium Film nicht angewiesen<br />
war. Die "Anfangszeiten" von 1966 waren<br />
es, denen die Medienzentrenleute von<br />
1985 ihre Sympathie bezeugten.<br />
Was der Kulturherrschaft unheimlich<br />
wird, ist der Umstand, daß sich immer mehr<br />
Leute Mut machen und sich nicht sagen<br />
lassen, Mut wozu. Programmatisch ist der<br />
Titel des neuen (dritten) Film der Wendländischen<br />
Filmcooperative: "Zwischenzeit".<br />
Die Musik ist von den Einstürzenden<br />
Neubauten, und es werden auch sonst ein<br />
paar Sensorien mehr angesprochen als wir<br />
es vom klassischen Dokumentarftlm gewöhnt<br />
sind. Gorleben und die Anti-AKW<br />
Bewegung sind wie in den beiden ersten<br />
Filmen - "Die Herren machen das selber,<br />
dass ihnen der arme Mann Feind wird"<br />
(1976-79) und "Traum von einer Sache"<br />
(1980/81) Thema,- aber jetzt entschieden<br />
mittelbar. Direkt geht es um mehr als um<br />
die Sache: um die Menschen, die in Gorleben<br />
1981-1985 zueinanderftnden, aufeinanderstoßen<br />
und sich wieder trennen.<br />
Vom Polizeisprecher, Wachmann und<br />
Standortrepräsentanten zum Untergrundarbeiter,<br />
Freizeitdemonstranten und<br />
Waldbauern. Die Filmmacher (Roswitha<br />
Ziegler, Niels Chr. Bollbrinker,Jochen Fölster,<br />
Gerhard Zigler) zögern nicht, jederzeit<br />
in das Geschehen einzugreifen und mit<br />
ästhetischen Mitteln der Filmdramaturgie<br />
Wirklichkeit zu verschaffen (oder doch<br />
mindestens punktuell zu verändern). Die<br />
Strategie des Films ist gleichzeitig eine<br />
Strategie des Widerstands (und nicht eine<br />
darüber). Und da der Film kreativ, phantasievoll,<br />
provokativ und auf nicht recht zu<br />
fassende Art ironisch-subversiv ist, lädt er<br />
zu entsprechendem, vor allem nicht recht<br />
zu fassendem Widerstand ein. Die Einladung<br />
der "Zwischenzeit" macht neuen<br />
Mut. Dies zunächst. "Zwischenzeit" ist<br />
selbst produziertes Ereignis. Und man sollte<br />
dieses sensationelle Ergebnis dadurch<br />
würdigen, daß man den Ereignis-Film aus<br />
der Sparte des Dokumentarftlms herausnimmt,<br />
der heute überwiegend mit den Negativerlebnissen<br />
Resignation, Frustration<br />
und Melancholie assoziiert wird.<br />
Der "Zwischenzeit"-Polizist, der eine<br />
Wendland-Straße sperrt, zieht plötzlich eine<br />
Pistole. Man spürt seinen Haß und seine<br />
Aggression gegenüber den Demonstranten.<br />
Diese freuen sich sichtlich über die gelungene<br />
Provokation. Über den kleinen<br />
Sieg. Polizistenkollegen reden dem Pistolenträger<br />
gut zu. Es scheint, daß die Demonstranten<br />
Herr dieser Lage sind. Doch<br />
freilich: die Atommülltransporte haben<br />
freie Fahrt. Von der Polizei gut gesichert<br />
und von Blockadeaktionen ungehindert erreichen<br />
sie ihr Ziel- vorbei am Akzeptanzforscher,<br />
der den "Zwischenzeit"-Film hindurch<br />
die Widerstandsaktionen begleitet.<br />
Mit dieser-fiktiven- Gestalt greift der Film<br />
in die Bewegung ein. Eine Erfindung, die -<br />
jetzt aber im Großen-genauso gut funktioniert,<br />
wie clie reale Szene mit dem Pistole<br />
ziehenden Polizisten. Der Akzeptanzforscher<br />
kommt vor Ort dem vorgeblichen<br />
Auftrag und der Aufgabe nach, die sogenannte<br />
Bewegung zu analysieren und Befriedungsstrategien<br />
zu entwickeln. Die<br />
Filmmacher lassen ihn zur handelnden Person<br />
in einer realen Anhörungsposse werden,<br />
zum absurden Interviewpartner des<br />
Bewachungs- und Sicherungs- Unternehmens,<br />
zu einer Art Empfangschef der Blokkadeorganisation.<br />
Mit falscher Routine begrüßt<br />
er Neuankömmlinge; mit falschem<br />
Verständnis läßt er vermummte Terroristen<br />
Pläne entwickeln; mit falschem Händedruck<br />
gliedert er sich der Menschenkette<br />
ein. Der Film zeigt gesprengte Hochspannungsmastenund<br />
die saubere Niederlegung<br />
eines Fabrikschornsteins.<br />
Das Forscher-Falsifikat operiert in diesem<br />
Film mit schlauen, eleganten Soziologentexten.<br />
Nicht weil der Text falsch oder<br />
mindestens der realen Situation unangemessen<br />
ist (beides triffi zu), sondern weil<br />
der Gebrauch des Textes und darüberhinaus<br />
der Gebrauch, den der Film von der<br />
inszenierten Figur macht, eine überaus befreiende<br />
(und sich im Gelächter ausdrük-