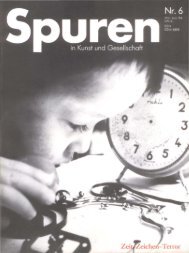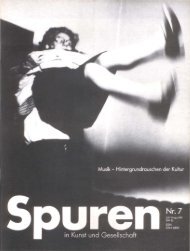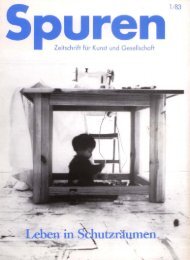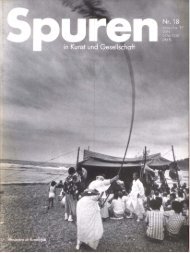Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Spur - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rezensionen<br />
vor in der Tradition des subjektzentrierten<br />
Denkens, und sei<br />
dies nur, um es zu überwinden<br />
(denn auch der Wunsch zu überwinden<br />
ist noch subjektiver<br />
Wunsch). Sie setzen den Hebel<br />
bei diesem Unternehmen - ganz<br />
mechanisch gedacht - am Gegenstand<br />
der Kritik, dem Denken<br />
des Subjekts, an und nicht schon<br />
bei dem Verhältnis von Abstraktem<br />
und Konkretem. Doch es ist<br />
genau die Verkennung dieses<br />
Verhältnisses, was zu der Vorstellung<br />
des Subjekts als 'denkendem<br />
Ding' allererst führte.<br />
Denken wird spätestens seit<br />
Descartes als- um es mit Holl zu<br />
sagen - substantielle Qualität<br />
von Individuen und nicht mehr<br />
als relationaler Aspekt eines<br />
Kontextes verstanden. Die Definition<br />
des Subjekts, das sich<br />
durchs Denken und durch Vernunft<br />
konstituiert wähnte, geriet<br />
dadurch hoffnungslos selbstbezügl<br />
ich . Die Konsequenzen dieses<br />
Zirkelschlusses bestehen in<br />
der bis heute gültigen Teilung<br />
der W irklichkeit in eine Weit materieller<br />
Körper und eine Sphäre<br />
geistiger 'Ereignisse' - eine Teilung,<br />
die nur im Kopf produziert<br />
wird, die aber dennoch oder ge-<br />
rade deshalb äußerst rea l ist.<br />
Diese Teilung ging schon auf<br />
Platon zurück, doch der cartesische<br />
Dualismus unterschied<br />
sich von platonischen dadurch,<br />
daß er an die Stelle einer holistischen<br />
Teilhabe der Materie an<br />
den Ideen die mechanische Verbindung<br />
von Körper und Geist<br />
setzte. Es war diese Setzung, die<br />
das so überaus erfolgreiche<br />
Konzept der empirischen Wissenschaften<br />
endgültig etablierte.<br />
Diesenwar nichtlängermeditative<br />
Wesensschau das Wichtigste<br />
an menschlicher Erkenntnis,<br />
sondern die Herstellung ei <br />
nes technischen Instrumentariums<br />
zur Beherrschbarmachung<br />
der Natur. Heute erleben<br />
wir immer augenfälliger - und<br />
nicht erst seit Tschernobyl -wie<br />
dieses Instrumentarium mit der<br />
ganzen Energie, mit der es in die<br />
Natur ' hineingepreßt' wurde,<br />
'zurückschlägt' : in Gestalt von<br />
ökologischer Zerstörung und<br />
technischen Katastrophen.<br />
Doch die auf Descartes folgende<br />
Ausgrenzung des Geistes<br />
aus der Materie (oder war sie<br />
umgekehrt?), beschränkte sich<br />
nicht nur auf die Naturwissenschaften.<br />
Auch die Geisteswissensehaften<br />
wurden von ihr betroffen,<br />
vielleicht in noch stärkerem<br />
Maße. Wenn keine Teilhabe,<br />
wie noch bei Platon, die Weit<br />
des Geistes und die WeltderMaterie<br />
verbindet, wie hat man sich<br />
deren Verhältnis zu denken?<br />
Kant beantwortet die Frage auf<br />
eine äußerst einfache, aber wie<br />
Holl meint, für seine Nachfolger<br />
' unerträgliche' Weise : er schlug<br />
vor, daß der an seinen Körpergebundene<br />
Mensch so tun solle,<br />
'als ob' ihm der metaphysische<br />
Bereich des Geistes zugänglich<br />
sei, obwohl er ganz genau wisse,<br />
daß er nie zu dessen genauer Erkenntis<br />
gelangen könne. ln dieser<br />
Antwort ist die gleiche Verkennung<br />
zu entdecken wie<br />
schon bei Descartes. Denn Kant<br />
bezeifelt an keinerStelle die<br />
Dualität von Geist und Materie.<br />
Doch er läßt es schulterzuckend<br />
dabei bewenden und beweist<br />
damit, laut Holl, eine spielerischere<br />
Haltung als seine Nachfolger.<br />
Diesen war Kants ' als ob'<br />
Lösung ein philosphischer<br />
Skandal. Sie versuchten - allen<br />
voran Hegel - von nun an jene<br />
Zerteilung der Wirklichkeit, die<br />
der Preis fürdie Installierung des<br />
Subjekts als 'denkendem Ding'<br />
war, zu überwinden. Es ist der<br />
Diskurs der Moderne, den Kants<br />
philosphischer Skandal nach<br />
sich zog . Nicht nurfür Habermas<br />
dreht sich dieser Diskurs um eine<br />
Vernunftkritik, die die realen Rat<br />
ionalisierungsschübe der gesellschaftlichen<br />
Entwicklung<br />
zum Gegenstand nimmt. Das<br />
Kritikwürdige daran ist, daß die<br />
selbstläufig gewordenen Entwicklung<br />
der Gesellschaft genausowenig<br />
wie der verlassene<br />
Traditionsfundus und der Ideenhimmel<br />
das intensive Bedürfnis<br />
des Subjekts nach Selbstvergew<br />
isserung in Freiheit befriedigen.<br />
Vernunftkrit ik wurde daher<br />
zu einer Gesellschaftskritik, die<br />
auf einem Standort beharrte,<br />
von dem aus die schlechte<br />
gesellschaftliche Wirklichkeit<br />
moralisch integer werden konnte.<br />
Genauso wie die Naturwissenschaften<br />
gingen die Geistesund<br />
Sozialwissenschaften dabei<br />
von der Trennung zwischen<br />
Theorie und Praxis aus. Es war<br />
die theoretische Vernunft, die<br />
sich moralisch integer wähnte<br />
und immer wieder den Irrtum<br />
wiederholte, der sie selbst erst<br />
bilden half: daß Theorie grundsätzlich<br />
in Praxis überführbar<br />
oder Abstraktes 'in Konkretes<br />
implantierbar' ist, wurde zu ihrer<br />
axiomatischen Staatsraison. Es<br />
war Nietzsche, derdieses Axiom<br />
als erster bezweifelte. Doch<br />
nicht nur das, er macht es auch<br />
lächerlich : jede Theorie war ihm<br />
mindestens so kritikwürdig wie<br />
die übelste Praxis. Hier nahm ei <br />
ne ldeolgiekritik ihren Anfang,<br />
die ihren Höhepunkt in der kritischen<br />
Theorie finden sollte. Sie<br />
sah die theoretischen und kritischen<br />
Potentiale der Philosophie<br />
selber als Teil der schlechten<br />
Wirklichkeit an und brachte<br />
sich auf paradoxe Weise scheinbar<br />
um den eigenen Standort.<br />
Von dieser sich selbst dementierenden<br />
und strangulierenden<br />
Vernunftkritik ist Batesons<br />
Verbindung von ' lockerem<br />
und strengem Denken' zu unterscheiden,<br />
in der ein kontextuelles<br />
Denken erprobt werden soll,<br />
das die ParadoYie von Vernunftkritik<br />
nicht eleminiert, sondern,<br />
auf eine an die Widersinnigkeit<br />
des Zen erinnernden Weise,<br />
fruchtbar nutzen soll. Mit dem<br />
Begriff des Kontextes unternahm<br />
Bateson den Versuch, das<br />
Verhältnis von Geist und Materie<br />
nicht mehr mechanisch zu denken.<br />
Selbstbezüglichkeit ist nur<br />
möglich durch die Transzendierung<br />
des Kontextes, in dem man<br />
sich gerade befindet. Man<br />
beachte allerdings, daß Bateson<br />
den Begriff des Kontextes über<br />
den menschlichen Selbstbezug<br />
hinaus auf die gesamte Biosphäre<br />
ausdehnte. Diese versuchte er<br />
als 'geistigen Prozess' zu beschreiben<br />
oder- wie ein anderer<br />
Ausdruck lautet - als 'ökologisches<br />
Diskursuniversum'. Man<br />
sehe sich die sechs Kriterien an,<br />
die für Bateson einen geistigen<br />
Prozess kennzeichnen:<br />
1. Er ist ein Aggregat mit<br />
Wechselwirkungen (Diese können<br />
entweder relational oder in<br />
Hinblick auf die wirkenden Teile<br />
beschrieben werden).<br />
2. Wechselwirkungen werden<br />
durch Unterschiede ausgelöst<br />
(Sie können zwischen Gegenständen,<br />
zwischen Relationen<br />
oder zwischen Gegenständen<br />
und Relationen bestehen).<br />
3. Der geistige Prozess besitzt<br />
kollaterale Energ ie (Das bedeutet,<br />
daß z.B. Bewegung nicht<br />
nur mechanisch übertragen wird<br />
- was zu der peinlichen Frage<br />
nach dem ersten Beweger<br />
führt -, sondern daß sie im geistigen<br />
Prozeß auf nicht- mechanische<br />
Weise und dezentral entsteht.<br />
So läuft ein getretener<br />
Hund nicht, weil ihn die Energie<br />
des Tritts in Bewegung setzt.<br />
sondern weil er selbst aktiv<br />
wird).<br />
4 . Der geistige Prozeß ist zirkulär<br />
bestimmt (Das versteht<br />
sich fast von selbst, da Wechselwirkungen<br />
nirgends in Leere laufen,<br />
sondern allenfalls in andere,<br />
69