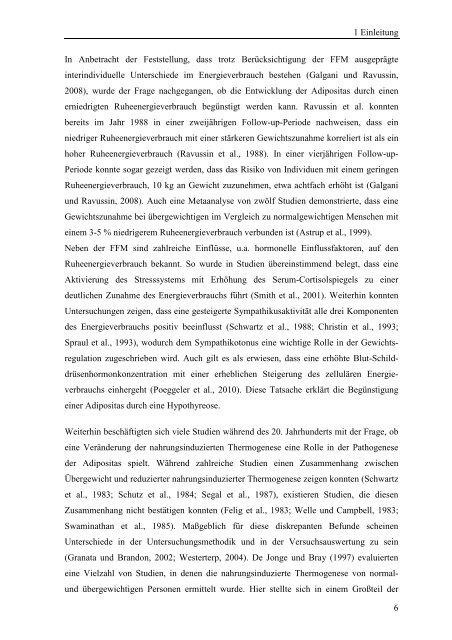Der Einfluss akuten Schlafentzugs auf den Energieverbrauch des ...
Der Einfluss akuten Schlafentzugs auf den Energieverbrauch des ...
Der Einfluss akuten Schlafentzugs auf den Energieverbrauch des ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1 Einleitung<br />
In Anbetracht der Feststellung, dass trotz Berücksichtigung der FFM ausgeprägte<br />
interindividuelle Unterschiede im <strong>Energieverbrauch</strong> bestehen (Galgani und Ravussin,<br />
2008), wurde der Frage nachgegangen, ob die Entwicklung der Adipositas durch einen<br />
erniedrigten Ruheenergieverbrauch begünstigt wer<strong>den</strong> kann. Ravussin et al. konnten<br />
bereits im Jahr 1988 in einer zweijährigen Follow-up-Periode nachweisen, dass ein<br />
niedriger Ruheenergieverbrauch mit einer stärkeren Gewichtszunahme korreliert ist als ein<br />
hoher Ruheenergieverbrauch (Ravussin et al., 1988). In einer vierjährigen Follow-up-<br />
Periode konnte sogar gezeigt wer<strong>den</strong>, dass das Risiko von Individuen mit einem geringen<br />
Ruheenergieverbrauch, 10 kg an Gewicht zuzunehmen, etwa achtfach erhöht ist (Galgani<br />
und Ravussin, 2008). Auch eine Metaanalyse von zwölf Studien demonstrierte, dass eine<br />
Gewichtszunahme bei übergewichtigen im Vergleich zu normalgewichtigen Menschen mit<br />
einem 3-5 % niedrigerem Ruheenergieverbrauch verbun<strong>den</strong> ist (Astrup et al., 1999).<br />
Neben der FFM sind zahlreiche Einflüsse, u.a. hormonelle <strong>Einfluss</strong>faktoren, <strong>auf</strong> <strong>den</strong><br />
Ruheenergieverbrauch bekannt. So wurde in Studien übereinstimmend belegt, dass eine<br />
Aktivierung <strong>des</strong> Stresssystems mit Erhöhung <strong>des</strong> Serum-Cortisolspiegels zu einer<br />
deutlichen Zunahme <strong>des</strong> <strong>Energieverbrauch</strong>s führt (Smith et al., 2001). Weiterhin konnten<br />
Untersuchungen zeigen, dass eine gesteigerte Sympathikusaktivität alle drei Komponenten<br />
<strong>des</strong> <strong>Energieverbrauch</strong>s positiv beeinflusst (Schwartz et al., 1988; Christin et al., 1993;<br />
Spraul et al., 1993), wodurch dem Sympathikotonus eine wichtige Rolle in der Gewichtsregulation<br />
zugeschrieben wird. Auch gilt es als erwiesen, dass eine erhöhte Blut-Schilddrüsenhormonkonzentration<br />
mit einer erheblichen Steigerung <strong>des</strong> zellulären <strong>Energieverbrauch</strong>s<br />
einhergeht (Poeggeler et al., 2010). Diese Tatsache erklärt die Begünstigung<br />
einer Adipositas durch eine Hypothyreose.<br />
Weiterhin beschäftigten sich viele Studien während <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts mit der Frage, ob<br />
eine Veränderung der nahrungsinduzierten Thermogenese eine Rolle in der Pathogenese<br />
der Adipositas spielt. Während zahlreiche Studien einen Zusammenhang zwischen<br />
Übergewicht und reduzierter nahrungsinduzierter Thermogenese zeigen konnten (Schwartz<br />
et al., 1983; Schutz et al., 1984; Segal et al., 1987), existieren Studien, die diesen<br />
Zusammenhang nicht bestätigen konnten (Felig et al., 1983; Welle und Campbell, 1983;<br />
Swaminathan et al., 1985). Maßgeblich für diese diskrepanten Befunde scheinen<br />
Unterschiede in der Untersuchungsmethodik und in der Versuchsauswertung zu sein<br />
(Granata und Brandon, 2002; Westerterp, 2004). De Jonge und Bray (1997) evaluierten<br />
eine Vielzahl von Studien, in <strong>den</strong>en die nahrungsinduzierte Thermogenese von normalund<br />
übergewichtigen Personen ermittelt wurde. Hier stellte sich in einem Großteil der<br />
6