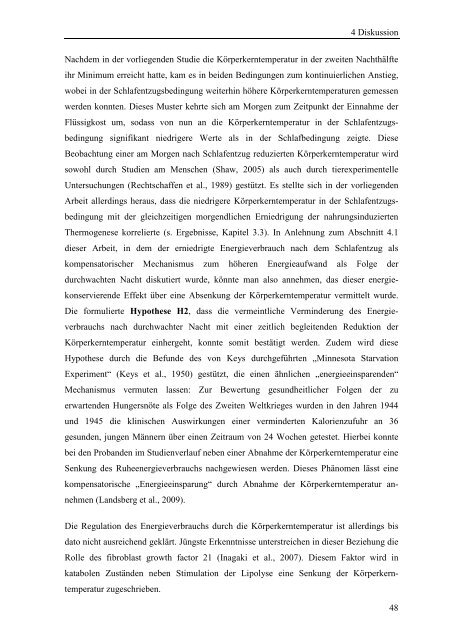Der Einfluss akuten Schlafentzugs auf den Energieverbrauch des ...
Der Einfluss akuten Schlafentzugs auf den Energieverbrauch des ...
Der Einfluss akuten Schlafentzugs auf den Energieverbrauch des ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 Diskussion<br />
Nachdem in der vorliegen<strong>den</strong> Studie die Körperkerntemperatur in der zweiten Nachthälfte<br />
ihr Minimum erreicht hatte, kam es in bei<strong>den</strong> Bedingungen zum kontinuierlichen Anstieg,<br />
wobei in der <strong>Schlafentzugs</strong>bedingung weiterhin höhere Körperkerntemperaturen gemessen<br />
wer<strong>den</strong> konnten. Dieses Muster kehrte sich am Morgen zum Zeitpunkt der Einnahme der<br />
Flüssigkost um, sodass von nun an die Körperkerntemperatur in der <strong>Schlafentzugs</strong>bedingung<br />
signifikant niedrigere Werte als in der Schlafbedingung zeigte. Diese<br />
Beobachtung einer am Morgen nach Schlafentzug reduzierten Körperkerntemperatur wird<br />
sowohl durch Studien am Menschen (Shaw, 2005) als auch durch tierexperimentelle<br />
Untersuchungen (Rechtschaffen et al., 1989) gestützt. Es stellte sich in der vorliegen<strong>den</strong><br />
Arbeit allerdings heraus, dass die niedrigere Körperkerntemperatur in der <strong>Schlafentzugs</strong>bedingung<br />
mit der gleichzeitigen morgendlichen Erniedrigung der nahrungsinduzierten<br />
Thermogenese korrelierte (s. Ergebnisse, Kapitel 3.3). In Anlehnung zum Abschnitt 4.1<br />
dieser Arbeit, in dem der erniedrigte <strong>Energieverbrauch</strong> nach dem Schlafentzug als<br />
kompensatorischer Mechanismus zum höheren Energie<strong>auf</strong>wand als Folge der<br />
durchwachten Nacht diskutiert wurde, könnte man also annehmen, das dieser energiekonservierende<br />
Effekt über eine Absenkung der Körperkerntemperatur vermittelt wurde.<br />
Die formulierte Hypothese H2, dass die vermeintliche Verminderung <strong>des</strong> <strong>Energieverbrauch</strong>s<br />
nach durchwachter Nacht mit einer zeitlich begleiten<strong>den</strong> Reduktion der<br />
Körperkerntemperatur einhergeht, konnte somit bestätigt wer<strong>den</strong>. Zudem wird diese<br />
Hypothese durch die Befunde <strong>des</strong> von Keys durchgeführten „Minnesota Starvation<br />
Experiment“ (Keys et al., 1950) gestützt, die einen ähnlichen „energieeinsparen<strong>den</strong>“<br />
Mechanismus vermuten lassen: Zur Bewertung gesundheitlicher Folgen der zu<br />
erwarten<strong>den</strong> Hungersnöte als Folge <strong>des</strong> Zweiten Weltkrieges wur<strong>den</strong> in <strong>den</strong> Jahren 1944<br />
und 1945 die klinischen Auswirkungen einer verminderten Kalorienzufuhr an 36<br />
gesun<strong>den</strong>, jungen Männern über einen Zeitraum von 24 Wochen getestet. Hierbei konnte<br />
bei <strong>den</strong> Proban<strong>den</strong> im Studienverl<strong>auf</strong> neben einer Abnahme der Körperkerntemperatur eine<br />
Senkung <strong>des</strong> Ruheenergieverbrauchs nachgewiesen wer<strong>den</strong>. Dieses Phänomen lässt eine<br />
kompensatorische „Energieeinsparung“ durch Abnahme der Körperkerntemperatur annehmen<br />
(Landsberg et al., 2009).<br />
Die Regulation <strong>des</strong> <strong>Energieverbrauch</strong>s durch die Körperkerntemperatur ist allerdings bis<br />
dato nicht ausreichend geklärt. Jüngste Erkenntnisse unterstreichen in dieser Beziehung die<br />
Rolle <strong>des</strong> fibroblast growth factor 21 (Inagaki et al., 2007). Diesem Faktor wird in<br />
katabolen Zustän<strong>den</strong> neben Stimulation der Lipolyse eine Senkung der Körperkerntemperatur<br />
zugeschrieben.<br />
48