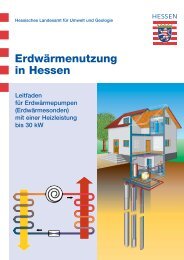Korrespondenz Abwasser · Abfall - COOPERATIVE Infrastruktur und ...
Korrespondenz Abwasser · Abfall - COOPERATIVE Infrastruktur und ...
Korrespondenz Abwasser · Abfall - COOPERATIVE Infrastruktur und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
852 Fachbeiträge<br />
9<br />
10<br />
Peripherie<br />
Geschoss-<br />
wohnungen 11<br />
Peripherie p<br />
Peripherie p<br />
Freizeit-/<br />
Streu-<br />
8<br />
Sportparks<br />
2<br />
siedlungen 12<br />
Peripherie<br />
Innenstadt-<br />
Innenstadt<br />
Peripherie<br />
1- <strong>und</strong> 2-<br />
randlage<br />
Industrie-<br />
Familienhäuser 7<br />
Innenstadt- InnenstadtrandlageMischgebiet<br />
3<br />
Innenstadtrandlage<br />
gebiet<br />
Geschosswohnungen<br />
g<br />
1<br />
Innenstadt<br />
Gewerbegebiet<br />
13<br />
Peripherie<br />
6<br />
KKern<br />
gebiet<br />
4<br />
Konversions<br />
gebiet<br />
InnenstadtInnenstadt-<br />
randlage<br />
randlage<br />
16<br />
Außengebiet<br />
Industrie-<br />
gebiet b<br />
5<br />
InnenstadtEntwicklungs-<br />
gebiet biGewerbe-<br />
randlage<br />
ggebiet 15<br />
Außengebiet<br />
Dorf<br />
Konversions-<br />
gebiet<br />
14<br />
Außengebiet g<br />
Kleinstadt<br />
Abb. 1: Stadtmodell „netWORKS“ mit potenziellen Teilräumen<br />
Teilräumlich wurde das Stadtmodell „netWORKS“ nach<br />
insgesamt 16 unterschiedlichen Stadtteilen mit ihren jeweils<br />
typischen Merkmalen differenziert (Abbildung 1), wie sie in<br />
deutschen Groß- oder Mittelstädten vorfindbar sind. Unabhängig<br />
von den spezifischen örtlichen Gegebenheiten einer<br />
konkreten Stadt wird jeweils nur ein Teilraum dargestellt. In<br />
der Realität wird es der Fall sein, dass Teilräume gar nicht<br />
oder mehrfach vorkommen. Für die Beschreibung der Modellstadt<br />
„netWORKS“ wird zunächst vereinfachend davon<br />
ausgegangen, dass die Teilräume eine weitgehend homogene<br />
Struktur aufweisen. Damit wird es möglich, typische teilräumliche<br />
Gegebenheiten, sozio-ökonomische Entwicklungslinien<br />
<strong>und</strong> Wasser-<strong>Infrastruktur</strong>systeme zugr<strong>und</strong>e zu legen. Im<br />
konkreten Fall müssen diese jeweils ermittelt <strong>und</strong> definiert<br />
werden.<br />
Die teilräumlichen Eckdaten hinsichtlich der Siedlungsstruktur<br />
(Besiedlungs- <strong>und</strong> Arbeitsplatzdichte, Gebäudeleerstand,<br />
Bebauungsdichte, Bausubstanz <strong>und</strong> Eigentümerstruktur)<br />
<strong>und</strong> der Wasserinfrastruktur (spezifischer Wasserbedarf<br />
<strong>und</strong> Leitungsdichte, Anteil Misch-/Trennsystem <strong>und</strong> Auslastung<br />
Schmutzwassernetz) sind in [13] zusammenfassend dargestellt<br />
<strong>und</strong> um die Eigenschaften der Teilräume in Form von<br />
Steckbriefen ausführlicher dokumentiert. Diese Daten <strong>und</strong> Informationen<br />
wurden in Fachgesprächen mit den Vertretern der<br />
Partnerstädte Bielefeld, Chemnitz, Cottbus, Essen, Hamburg<br />
<strong>und</strong> Schwerin diskutiert <strong>und</strong> abgestimmt.<br />
2.2 Szenarien kommunaler Wasser-<strong>Infrastruktur</strong>en<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Ökoeffizienz-Analyse waren die drei folgenden<br />
Systemvarianten kommunaler Wasser-<strong>Infrastruktur</strong>en, bestehend<br />
aus dem Ausgangszustand <strong>und</strong> zwei darauf aufbauenden<br />
unterschiedlichen Systementwicklungen (Szenarien). Aufgr<strong>und</strong><br />
des hohen Anteils der Kapitalkosten <strong>und</strong> der langen Ausreifungszeit<br />
der kommunalen Wasser-<strong>Infrastruktur</strong>, aber auch<br />
wegen der Dauerhaftigkeit städtischer Strukturen <strong>und</strong> der<br />
Wirtschaft<br />
Langfristigkeit räumlicher Entwicklungen, wurde dazu ein<br />
Zeithorizont von 70 Jahren gewählt:<br />
● Status quo 2010 (System im Ist-Zustand),<br />
● Referenz 2080 (Szenario der Systemoptimierung/-anpassung)<br />
<strong>und</strong><br />
● Transformation 2080 (Szenario der gr<strong>und</strong>legenden Systemumgestaltung).<br />
Für die Entwicklung der Systemvarianten bzw. der Szenarien<br />
gelten gr<strong>und</strong>sätzlich die nachstehenden Randbedingungen:<br />
● Bevölkerungsrückgang von 25 %,<br />
● identische städtebauliche Entwicklung,<br />
● keine Änderung der jährlichen Niederschlagsmenge,<br />
● Fortführung der zentralen Trinkwasserversorgung,<br />
● Bezug ausschließlich auf häusliche Abwässer,<br />
● Systemgrenzen auf der <strong>Abwasser</strong>seite schließen die Klärschlammentwässerung<br />
ein. Klärschlammentsorgung <strong>und</strong><br />
Mitbehandlung häuslicher Bioabfälle werden qualitativ/argumentativ,<br />
jedoch nicht quantitativ berücksichtigt.<br />
Die Systemvariante „Status quo 2010“ beschreibt eine heute übliche<br />
Systemstruktur der zentralen Wasserversorgung <strong>und</strong> <strong>Abwasser</strong>beseitigung.<br />
Diese besteht aus einer zentralen Trinkwasserversorgung<br />
(inklusive Löschwasserbereitstellung), die einen<br />
spezifischen Trinkwasserverbrauch von 45 m 3 /(E � a) bzw. 124<br />
L/(E � d) deckt. Anfallendes Niederschlagswasser wird häufig<br />
zur Gartenbewässerung, vereinzelt auch für Toilettenspülung<br />
<strong>und</strong> sonstige Nutzungen verwendet. Die zentral ausgerichtete<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitung ist überwiegend im Mischsystem mit klassischer<br />
Schwerkraftentwässerung ausgestaltet. Kohlenstoff- <strong>und</strong><br />
Stickstoffverbindungen werden mittels aerober <strong>und</strong> anoxischer<br />
Verfahren (Denitrifikation) entfernt, der anfallende Klärschlamm<br />
wird anaerob stabilisiert <strong>und</strong> das entsprechende Faulgas intern<br />
energetisch verwertet (Eigenversorgung). Mittels Simultanfällung<br />
<strong>und</strong> ergänzend vermehrt biologisch wird der Nährstoff<br />
Phosphor aus dem <strong>Abwasser</strong> entfernt. Es erfolgt eine stoffliche<br />
<strong>und</strong> thermische Klärschlammentsorgung.<br />
Die zugehörige Systemskizze zeigt Abbildung 2. Hier sind<br />
aufbauend zum Status quo (konventionelle Techniken, bestehendes<br />
System) die wesentlichen Systemkomponenten bzw.<br />
Änderungen im Referenz-Szenario (alternative Techniken, neues<br />
System) vergleichend dargestellt.<br />
Das Referenz-Szenario für den Bezugshorizont 2080 stellt<br />
eine Fortschreibung des bestehenden Wasserinfrastruktursystems<br />
der Ausgangslage des Status quo 2010 dar (Abbildung 2)<br />
<strong>und</strong> unterscheidet sich hiervon im Wesentlichen durch:<br />
● einen verringerten einwohnerspezifischen Trinkwasserverbrauch<br />
von 34 m 3 /(E � a) bzw. 93 L/(E � d) (wassersparende<br />
Armaturen <strong>und</strong> Geräte),<br />
● eine Trinkwassersubstitution durch erhöhte Regenwassernutzung,<br />
● teilweise Abkopplung der Löschwasser- von der Trinkwasserversorgung,<br />
● eine vermehrte Ableitung des <strong>Abwasser</strong>s im Trennsystem,<br />
● die Nutzung eines Teils des Wärmepotenzials des <strong>Abwasser</strong>s,<br />
● eine Energieeffizienzsteigerung in der <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
<strong>und</strong> energetische Faulgasverwertung,<br />
● eine Mitbehandlung von Bioabfällen auf der <strong>Abwasser</strong>behandlungsanlage,<br />
KA <strong>Korrespondenz</strong> <strong>Abwasser</strong>, <strong>Abfall</strong> <strong>·</strong> 2011 (58) <strong>·</strong> Nr. 9 www.dwa.de/KA