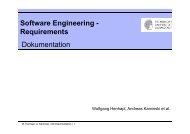Pflichtenheft von byteme - PI - Praktische Informatik
Pflichtenheft von byteme - PI - Praktische Informatik
Pflichtenheft von byteme - PI - Praktische Informatik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A.2. KONZEPTE 79<br />
hen, die unabhängig <strong>von</strong> bestimmten Endgeräten und unabhängig <strong>von</strong> einer bestimmten<br />
Implementierung ist.<br />
Für bestimmte Themen, z.B. William Shakespeare, Ben Johnson, ihre Stücke Hamlet<br />
und Volpone, und die Städte London und Stratford, wollen wir für alle Stellen in<br />
der elektronischen Enzyklopädie - Textpassagen, Bilder oder Tondokumente - festhalten,<br />
wo sie besprochen, abgebildet oder sonstwie erwähnt werden. Wir nennen diese<br />
Vorkommnisse „Occurences“ dieser Themen. Unterschiedliche Occurences können auf<br />
unterschiedliche Weise auf ihr Thema bezug nehmen. Dies wollen wir ebenfalls unterscheiden.<br />
Detaillierte Besprechungen, kurze Erwähnungen und Abbildungen müssen<br />
<strong>von</strong>einander unterschieden werden, damit Benutzer schneller das gesuchte finden können.<br />
Die Enzyklopädie, mit der wir arbeiten, existiert in elektronischer Form, so dass jede<br />
Occurence eines Themas eine elektronische Ressource ist. Somit hat jede Ressource<br />
eine Adresse. (Ohne ins Detail über den Aufbau <strong>von</strong> Adressen zu gehen, definieren wir<br />
eine Adresse als einen Ausdruck, der dem Computer erlaubt, eine Ressource zu lokalisieren.)<br />
Es sind also adressierbare Informationsressourcen.<br />
Die Autoren William Shakespeare und Ben Johnson sind dagegen keine adressierbaren<br />
Ressourcen. Sie sind überhaupt keine elektronischen Dinge, sondern Menschen.<br />
Um die Verbindung zwischen einer Occurence eines Themas und dem Thema selbst zu<br />
repräsentieren, würde man gerne der Reihe nach auf beide zeigen und sagen „an dieser<br />
Stelle wird dieses Thema behandelt“ (oder diesen Vorgang in sein elektronisches Äquivalent<br />
übersetzen, indem man die Adresse der Occurence und die Adresse des Themas<br />
angibt und die Verbindung dazwischen in einer Beschreibungssprache formuliert).<br />
Da nicht alle Themen in elektronischer Form vorliegen, können wir folglich manchmal<br />
keine Adresse dafür angeben. Stattdessen können wir einen elektronischen Ersatz<br />
für das Thema erzeugen. Dieser Ersatz heißt „Topic“. Jedes Topic ist ein Platzhalter<br />
für ein bestimmtes Thema. Man sagt, das Topic vergegenständlicht das Thema oder<br />
macht das Thema für das System greifbar. Das Erstellen eines Topics für ein bestimmtes<br />
Thema erlaubt dem System, die Charakteristika eines Themas zu manipulieren, zu<br />
verarbeiten und zuzuweisen, indem diese Operationen mit dem entsprechenden Topic<br />
vorgenommen werden. Wenn wir eine Adresse für das Thema benötigen, benutzen wir<br />
die Adresse seines Topics, das dem System bekannt ist.<br />
(Da jedes Topic ein Thema repräsentiert und jedes Thema als Vorlage für ein Topic<br />
dienen kann, ist die Unterscheidung manchmal nicht wichtig. Daher werden in diesen<br />
Fällen die Begriffe Topic und Thema gleichwertig benutzt.)<br />
Da die Menge der Indexeinträge eine Art Karte der Enzyklopädie darstellen, die<br />
zeigt, an welcher Stelle bestimmte Themen behandelt werden, nennen wir die elektronische<br />
Entsprechung eines Index eine Topicmap.<br />
Topics, die einige <strong>von</strong> William Shakespeares Werken repräsentieren, könnten in<br />
etwa so aussehen:<br />
<br />
<br />
<br />
Hamlet, Prince of Denmark<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />