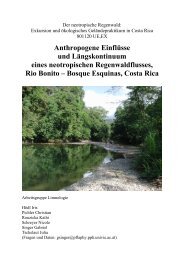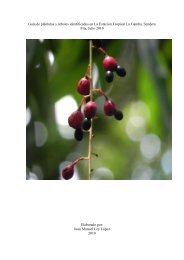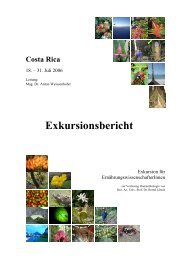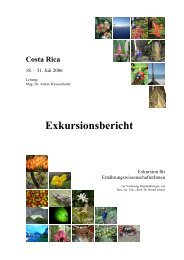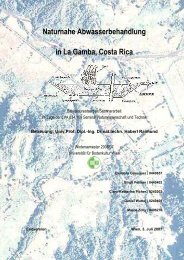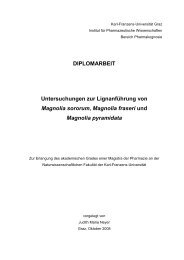Die Tropenstation La Gamba
Die Tropenstation La Gamba
Die Tropenstation La Gamba
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> „<strong>Tropenstation</strong> <strong>La</strong> <strong>Gamba</strong>“ in Costa Rica – Wissenschaftlicher Bericht<br />
HUBER, W.:, WEBER, A.: Hemiepiphyten und ihre Verteilung im Bosque Esquinas<br />
(Costa Rica). - 14. Symp. Biodiv. Evolutionsbiol. Jena 1999: 85.<br />
Hemiepiphyten sind Pflanzen, die in der Jugendphase epiphytisch leben und<br />
erst sekundär durch die Entwicklung langer Wurzeln einen Bodenkontakt herstellen. Sie<br />
spielen neben den Lianen und den Epiphyten eine wichtige Rolle in der Struktur und<br />
Zusammensetzung tropischer Wälder.<br />
Im Bosque Esquinas ("Regenwald der Österreicher", Costa Rica), wurden auf<br />
(bisher) zwei ökologisch unterschiedlichen Untersuchungsflächen (je 1 ha in einem<br />
Schluchtwald und einem Hügelkamm) alle Bäume (>10 cm dbh) sowie alle darauf<br />
wachsenden Hemiepiphyten aufgenommen. Es konnten ca. 50 Hemiepiphyten-Arten aus<br />
12 Familien aufgefunden werden. Von den aufgenommenen Bäumen waren etwa 15 %<br />
mit Hemiepiphyten vergesellschaftet. Hinsichtlich der Verteilung zeigte sich, dass die<br />
Hemiepiphyten im Schluchtwald mit mehr Individuen (127 auf 482 Trägerbäumen) und<br />
mit z.T. anderen Arten und Häufigkeiten vertreten waren als auf dem trockeneren, etwas<br />
höher gelegeneren (80 m Seehöhe) Hügelkamm (94 auf 458 Trägerbäumen). Besonders<br />
auffällig war die Verteilung der 9 Ficus-Arten: 5 Arten kamen ausschließlich im<br />
Kammwald vor und 4 andere Arten im nur ca. 300 m entfernten. Als die häufigsten<br />
Arten im Schluchtwald konnten Topopea maurofernandeziana (21 Individuen), Blakea<br />
litoralis (37), Schefflera systyla (12) und Bursera standleyana (7) festgestellt werden.<br />
Hingegen waren im Kammwald (250 m Seehöhe) Clusia amazonica (10) und<br />
Cavendishia callista (23) die häufigsten Arten. Es ist geplant, weitere Probeflächen zu<br />
untersuchen, womit eine tragfähige Grundlage geschaffen werden soll, die Signifikanz,<br />
die ökologische Position und Verteilung sowie die Ausbreitungs- und<br />
Etablierungsstrategien von Hemiepiphyten besser zu verstehen.<br />
<strong>Die</strong> bisherigen Untersuchungen lassen einen Zusammenhang zwischen<br />
Fruchttyp und -verbreiter der Hemiepiphyten und der Trägerbäume vermuten: Beide<br />
besitzen durchwegs Diasporen, die von Tieren (Fledermäusen oder Vögeln) ausgebreitet<br />
werden und es scheint, dass es eine Überlappung der Fruchtreifezeit des Wirts und des<br />
Hemiepiphyten gibt. Wenn die Fruchtreife zur gleichen Zeit stattfindet, vergrößert sich<br />
die Wahrscheinlichkeit, dass die Diasporen des Hemiepiphyten zu einem potentiellen<br />
Trägerbaum gelangen, indem dieser mit seinen Früchten das gleiche Tier anlockt. So läßt<br />
sich etwa die Beobachtung erklären, dass jeder Baum der Fabaceae Dussia martinicensis<br />
(auf Bäumen mit > 15 cm dbh) mit verschiedenen Hemiepiphyten besetzt war, die alle<br />
zur gleichen Zeit fruchteten wie der Wirt selbst.<br />
<strong>Die</strong> Ausbreitung allein reicht noch nicht für die Etablierung eines neuen Hemiepiphyten.<br />
In orientierenden Versuchen an ausgewählten Pflanzen wurde festgestellt,<br />
dass die Keimung der Samen nur bei konstant reichlichem Wasserangebot erfolgt. Das<br />
wirft die Frage auf, welche Bedeutung die Struktur und damit das Wasserhaltevermögen<br />
der Borke des Trägerbaumes hat. Viele weitere Fragen sind noch offen, z.B. ob und<br />
welchen Einfluss Hemiepiphyten auf die Mortalität der Wirtsbäume haben, wie die<br />
konkrete Etablierung der Jungpflanzen erfolgt, welche ökophysiologische Strategien<br />
(z.B. CAM bei Clusia) verfolgt werden. Sie sollen in weiterführenden Untersuchungen<br />
geklärt werden.<br />
Anschrift der Autoren:<br />
Univ. Prof. Dr. Anton Weber & Dr. Werner Huber<br />
Inst. f. Botanik, Rennweg 14, A-1030 Wien,<br />
Tel. ++43-1-4277-54080 bzw. 54083<br />
Fax. ++43-1-4277-9541<br />
anton.weber@univie.ac.at - werner.huber@univie.ac.at<br />
73