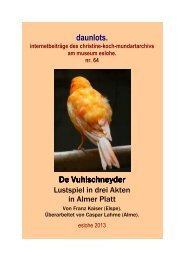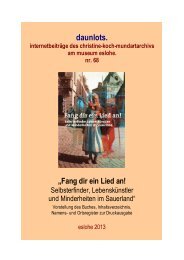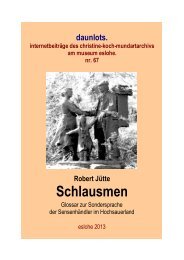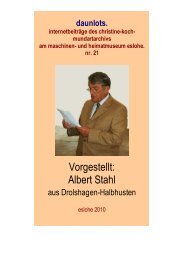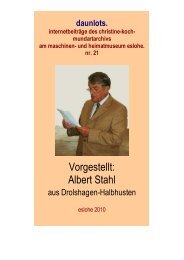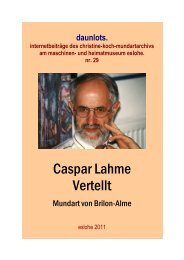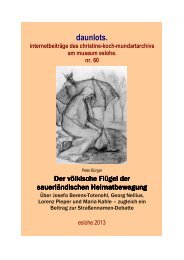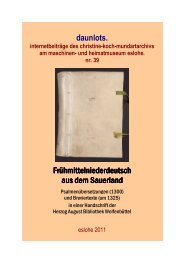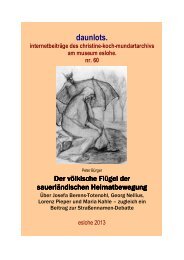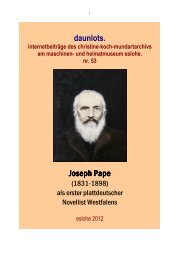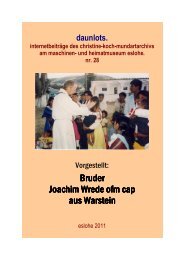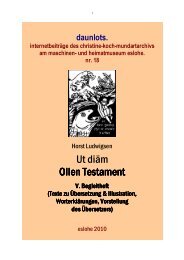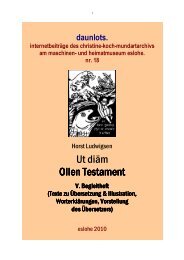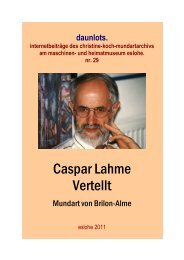Johann Friedrich Leopold Woeste - Christine Koch Mundartarchiv
Johann Friedrich Leopold Woeste - Christine Koch Mundartarchiv
Johann Friedrich Leopold Woeste - Christine Koch Mundartarchiv
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
9<br />
hätte finden sollen“. Das mehrbändige „Völkerstimmen“-Werk von<br />
JOHANNES MATTHIAS FIRMENICH (1808-1889), an dessen Fortsetzung<br />
er hernach ja auch mitgewirkt hat, ist – nach Schönhoff und Schulte-<br />
Kemminghausen – für <strong>Woeste</strong>s Bemühungen um die plattdeutschen<br />
„Volksüberlieferungen“ ein wichtiger Impuls gewesen. – Allerdings<br />
hatte er als Theologiestudent bereits die Arbeit des mit JACOB GRIMM<br />
bekannte Sprach- und Mundartforschers JOHANN GOTTLIEB RADLOF<br />
(1775–1846) zur Kenntnis genommen. Dieser stellte 1817 anhand der<br />
Jesus-Gleichnisse vom Sämann und vom verlorenen Sohn „Die Sprachen<br />
der Germanen in ihren sämmtlichen Mundarten“ dar und veröffentlichte<br />
ab 1821 seinen zweibändigen „Mustersaal aller teutschen<br />
Mundarten“.<br />
Der Berliner Forscher Dr. ADALBERT KUHN (1812-1881) veröffentlichte<br />
nach <strong>Woeste</strong> – und von diesem eifrig mit Material versorgt<br />
– in zwei Bänden seine „Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen“<br />
(1859). In diesem wichtigen Unternehmen konnte auch manche<br />
Mitteilung aus dem kölnischen Sauerland, das A. KUHN zusammen<br />
<strong>Woeste</strong> ebenfalls aufgesucht hat, Aufnahme finden.<br />
Daß im 19. Jahrhundert auch für Südwestfalen in nennenswertem<br />
Umfang plattdeutsche Leuteüberlieferungen sowie mundartliche<br />
Märchen, Sagen und Legenden aufgezeichnet worden sind, ist wohl<br />
allein J.F.L. <strong>Woeste</strong> zu verdanken. Eine zeitlang scheint <strong>Woeste</strong> unschlüssig<br />
gewesen zu sein, welcher „romantischen Richtung“ er als<br />
Überlieferer stärker folgen soll. 1844 veröffentlicht er einen Beitrag<br />
„Altsassischer Wechselgesang“, der ganz dem Mittelalter zugewandt<br />
ist; doch 1848 können wir dann nachlesen, daß es sich bei dem 1844<br />
zitierten Wechselgesang wohl einfach um ein plattdeutsches Flachslied<br />
aus Hemer handelt (Texte: →Seite 54-56; Seite 68).<br />
<strong>Woeste</strong> als Sprachforscher<br />
Nicht nur mit dieser Sammeltätigkeit wandelt <strong>Woeste</strong> in den<br />
Fußspuren der Brüder JACOB und WILHELM GRIMM, die als<br />
„Gründungsväter der Germanistik“ gelten. <strong>Woeste</strong> betrieb nämlich<br />
auch intensive Forschungen zur niederdeutschen Philologie, die<br />
selbstredend nach 150 Jahren weiterer Forschung nicht in allen Teilen<br />
Bestand haben (die Fülle seiner Veröffentlichungen ist noch immer<br />
nicht hinreichend bibliographiert). Dabei folgte er einer nachdrück-