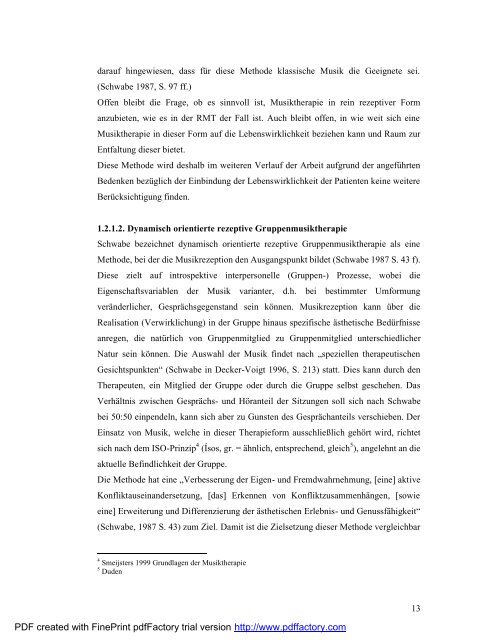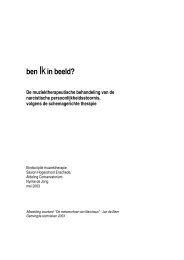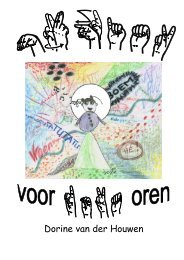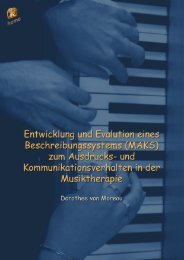2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
darauf hingewiesen, dass für diese Methode klassische Musik die Geeignete sei.(Schwabe 1987, S. 97 ff.)Offen bleibt die Frage, ob es sinnvoll ist, Musiktherapie in rein rezeptiver Formanzubieten, wie es in der RMT der Fall ist. Auch bleibt offen, in wie weit sich eineMusiktherapie in dieser Form auf die Lebenswirklichkeit beziehen kann und Raum zurEntfaltung dieser bietet.Diese Methode wird deshalb im weiteren Verlauf der Arbeit aufgrund der angeführtenBedenken bezüglich der Einbin<strong>du</strong>ng der Lebenswirklichkeit der Patienten keine weitereBerücksichtigung finden.1.<strong>2.</strong>1.<strong>2.</strong> Dynamisch orientierte rezeptive GruppenmusiktherapieSchwabe bezeichnet dynamisch orientierte rezeptive Gruppenmusiktherapie als eineMethode, bei der die Musikrezeption den Ausgangspunkt bildet (Schwabe 1987 S. 43 f).Diese zielt auf introspektive interpersonelle (Gruppen-) Prozesse, wobei dieEigenschaftsvariablen der Musik varianter, d.h. bei bestimmter Umformungveränderlicher, Gesprächsgegenstand sein können. Musikrezeption kann über dieRealisation (Verwirklichung) in der Gruppe hinaus spezifische ästhetische Bedürfnisseanregen, die natürlich von Gruppenmitglied zu Gruppenmitglied unterschiedlicherNatur sein können. Die Auswahl der Musik findet nach „speziellen therapeutischenGesichtspunkten<strong>“</strong> (Schwabe in Decker-Voigt 1996, S. 213) statt. Dies kann <strong>du</strong>rch denTherapeuten, ein Mitglied der Gruppe oder <strong>du</strong>rch die Gruppe selbst geschehen. DasVerhältnis zwischen Gesprächs- und Höranteil der Sitzungen soll sich nach Schwabebei 50:50 einpendeln, kann sich aber zu Gunsten des Gesprächanteils verschieben. DerEinsatz von Musik, welche in dieser Therapieform ausschließlich gehört wird, richtetsich nach dem ISO-Prinzip 4 (Ísos, gr. = ähnlich, entsprechend, gleich 5 ), angelehnt an dieaktuelle Befindlichkeit der Gruppe.Die Methode hat eine „Verbesserung der Eigen- und Fremdwahrnehmung, [eine] aktiveKonfliktauseinandersetzung, [das] Erkennen von Konfliktzusammenhängen, [sowieeine] Erweiterung und Differenzierung der ästhetischen Erlebnis- und Genussfähigkeit<strong>“</strong>(Schwabe, 1987 S. 43) zum Ziel. Damit ist die Zielsetzung dieser Methode vergleichbar4 Smeijsters 1999 Grundlagen der Musiktherapie5 DudenPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com13