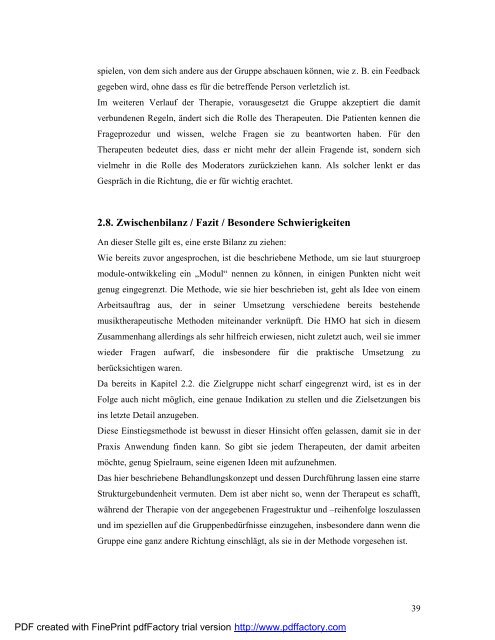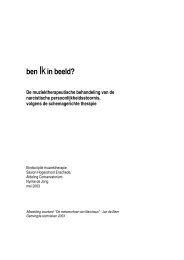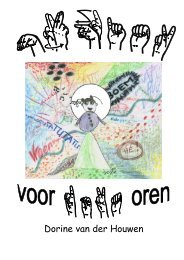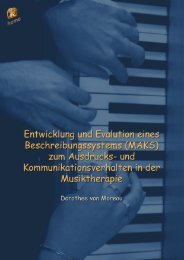2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
spielen, von dem sich andere aus der Gruppe abschauen können, wie z. B. ein Feedbackgegeben wird, ohne dass es für die betreffende Person verletzlich ist.Im weiteren Verlauf der Therapie, vorausgesetzt die Gruppe akzeptiert die damitverbundenen Regeln, ändert sich die Rolle des Therapeuten. Die Patienten kennen dieFrageproze<strong>du</strong>r und wissen, welche Fragen sie zu beantworten haben. Für denTherapeuten bedeutet dies, dass er <strong>nicht</strong> mehr der allein Fragende ist, sondern sichvielmehr in die Rolle des Moderators zurückziehen kann. Als solcher lenkt er dasGespräch in die Richtung, die er für wichtig erachtet.<strong>2.</strong>8. Zwischenbilanz / Fazit / Besondere SchwierigkeitenAn dieser Stelle gilt es, eine erste Bilanz zu ziehen:Wie bereits zuvor angesprochen, ist die beschriebene Methode, um sie laut stuurgroepmo<strong>du</strong>le-ontwikkeling ein „Mo<strong>du</strong>l<strong>“</strong> nennen zu können, in einigen Punkten <strong>nicht</strong> weitgenug eingegrenzt. Die Methode, wie sie hier beschrieben ist, geht als Idee von einemArbeitsauftrag aus, der in seiner Umsetzung verschiedene bereits bestehendemusiktherapeutische Methoden miteinander verknüpft. Die HMO hat sich in diesemZusammenhang allerdings als sehr hilfreich erwiesen, <strong>nicht</strong> zuletzt auch, weil sie immerwieder Fragen aufwarf, die insbesondere für die praktische Umsetzung zuberücksichtigen waren.Da bereits in Kapitel <strong>2.</strong><strong>2.</strong> die Zielgruppe <strong>nicht</strong> scharf eingegrenzt wird, ist es in derFolge auch <strong>nicht</strong> möglich, eine genaue Indikation zu stellen und die Zielsetzungen bisins letzte Detail anzugeben.Diese Einstiegsmethode ist bewusst in dieser Hinsicht offen gelassen, damit sie in derPraxis Anwen<strong>du</strong>ng finden kann. So gibt sie jedem Therapeuten, der damit arbeitenmöchte, genug Spielraum, seine eigenen Ideen mit aufzunehmen.Das hier beschriebene Behandlungskonzept und dessen Durchführung lassen eine starreStrukturgebundenheit vermuten. Dem ist aber <strong>nicht</strong> so, wenn der Therapeut es schafft,während der Therapie von der angegebenen Fragestruktur und –reihenfolge loszulassenund im speziellen auf die Gruppenbedürfnisse einzugehen, insbesondere dann wenn dieGruppe eine ganz andere Richtung einschlägt, als sie in der Methode vorgesehen ist.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com39