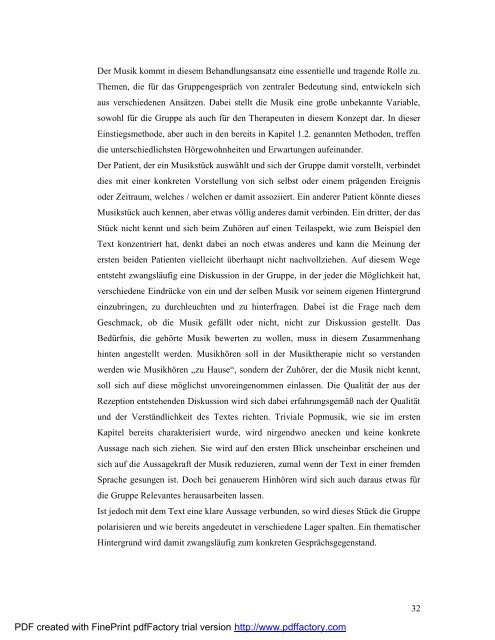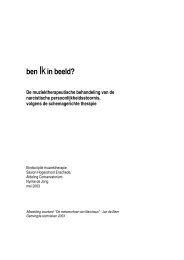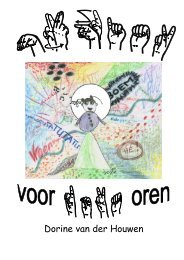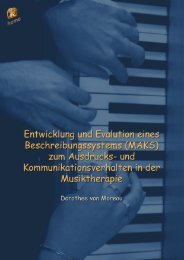2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
2. „Ich höre was, was du nicht hörst!“
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Musik kommt in diesem Behandlungsansatz eine essentielle und tragende Rolle zu.Themen, die für das Gruppengespräch von zentraler Bedeutung sind, entwickeln sichaus verschiedenen Ansätzen. Dabei stellt die Musik eine große unbekannte Variable,sowohl für die Gruppe als auch für den Therapeuten in diesem Konzept dar. In dieserEinstiegsmethode, aber auch in den bereits in Kapitel 1.<strong>2.</strong> genannten Methoden, treffendie unterschiedlichsten Hörgewohnheiten und Erwartungen aufeinander.Der Patient, der ein Musikstück auswählt und sich der Gruppe damit vorstellt, verbindetdies mit einer konkreten Vorstellung von sich selbst oder einem prägenden Ereignisoder Zeitraum, welches / welchen er damit assoziiert. Ein anderer Patient könnte diesesMusikstück auch kennen, aber et<strong>was</strong> völlig anderes damit verbinden. Ein dritter, der dasStück <strong>nicht</strong> kennt und sich beim Zu<strong>höre</strong>n auf einen Teilaspekt, wie zum Beispiel denText konzentriert hat, denkt dabei an noch et<strong>was</strong> anderes und kann die Meinung derersten beiden Patienten vielleicht überhaupt <strong>nicht</strong> nachvollziehen. Auf diesem Wegeentsteht zwangsläufig eine Diskussion in der Gruppe, in der jeder die Möglichkeit hat,verschiedene Eindrücke von ein und der selben Musik vor seinem eigenen Hintergrundeinzubringen, zu <strong>du</strong>rchleuchten und zu hinterfragen. Dabei ist die Frage nach demGeschmack, ob die Musik gefällt oder <strong>nicht</strong>, <strong>nicht</strong> zur Diskussion gestellt. DasBedürfnis, die gehörte Musik bewerten zu wollen, muss in diesem Zusammenhanghinten angestellt werden. Musik<strong>höre</strong>n soll in der Musiktherapie <strong>nicht</strong> so verstandenwerden wie Musik<strong>höre</strong>n „zu Hause<strong>“</strong>, sondern der Zu<strong>höre</strong>r, der die Musik <strong>nicht</strong> kennt,soll sich auf diese möglichst unvoreingenommen einlassen. Die Qualität der aus derRezeption entstehenden Diskussion wird sich dabei erfahrungsgemäß nach der Qualitätund der Verständlichkeit des Textes richten. Triviale Popmusik, wie sie im erstenKapitel bereits charakterisiert wurde, wird nirgendwo anecken und keine konkreteAussage nach sich ziehen. Sie wird auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen undsich auf die Aussagekraft der Musik re<strong>du</strong>zieren, zumal wenn der Text in einer fremdenSprache gesungen ist. Doch bei genauerem Hin<strong>höre</strong>n wird sich auch daraus et<strong>was</strong> fürdie Gruppe Relevantes herausarbeiten lassen.Ist jedoch mit dem Text eine klare Aussage verbunden, so wird dieses Stück die Gruppepolarisieren und wie bereits angedeutet in verschiedene Lager spalten. Ein thematischerHintergrund wird damit zwangsläufig zum konkreten Gesprächsgegenstand.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com32