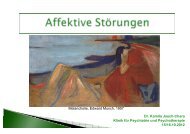Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie ...
Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie ...
Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>kalkulierten</strong> <strong>parenteralen</strong> <strong>Initialtherapie</strong> bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen – Update 2010<br />
72. Sermet-Gaudelus I, Hulin A, Ferroni A,<br />
Silly C, et al. Pharmacologic particularities<br />
of antibiotics in cystic fibrosis. Arch,<br />
Pediatr 2000;7:519-28.<br />
73. Servais H, Tulkens PM. Stability and<br />
compatibility of ceftazidime administered<br />
by continuous infusion to intensive<br />
care patients. Antimicrob Agents<br />
Chemother 2001;45:2643-7.<br />
74. Soy D, Lopez E, Ribas J. Teicoplanin<br />
population pharmacokinetic analysis in<br />
hospitalized patients. Ther Drug Monit<br />
2006;28:737-43.<br />
75. Tam VH, Louie A, Lomaestro BM,<br />
Drusano GL. Integration of population<br />
pharmacokinetics, a pharmacodynamic<br />
target, and microbiologic surveillance<br />
data to generate a rational empiric<br />
dosing strategy for cefepime against<br />
Pseudomonas aeruginosa. Pharmacother<br />
2003;23:291-5.<br />
76. Tessier PR, Nicolau DP, Onyeji CO,<br />
Nightingale CH. Pharmacodynamics of<br />
intermittent- and continuous-infusion<br />
cefepime alone and in combination<br />
with once-daily tobramycin against<br />
Pseudomonas aeruginosa in an in<br />
vitro infection model. Chemother<br />
1999;45:284-95.<br />
77. Thalhammer F, Traunmüller F, El<br />
Menyawi I, Frass M, et al. Continuous<br />
infusion versus intermittent administration<br />
of meropenem in critically<br />
ill patients. J Antimicrob Chemother<br />
1999;43:523-7.<br />
4. Sicherheit und<br />
Verträglichkeit<br />
Ralf Stahlmann, Hartmut Lode<br />
Bei etwa 10 % der behandelten Patienten<br />
muss mit unerwünschten Wirkungen<br />
gerechnet werden. Dies gilt für die<br />
meisten parenteral gegebenen Antibiotika.<br />
In einigen Fällen liegt die Häufigkeit<br />
der unerwünschten Arzneimittelwirkungen<br />
auch höher. Von besonderer Bedeutung<br />
ist die Frage nach Unterschieden in<br />
der Verträglichkeit der verfügbaren Präparate.<br />
Es ist allerdings nicht gerechtfertigt,<br />
die Ergebnisse aus verschiedenen Studien<br />
der klinischen Prüfung von neuen Arzneimitteln<br />
direkt miteinander zu vergleichen,<br />
um Unterschiede in der Verträglichkeit<br />
von Arzneistoffen zu bewerten. Trotz<br />
weitgehender Standardisierung der klinischen<br />
Prüfung stellen nur Daten aus Vergleichsstudien,<br />
vorzugsweise Doppelblindstudien,<br />
die einzige zuverlässige Quelle<br />
für direkte Vergleiche zwischen verschiedenen<br />
Arzneimitteln dar. Dies gilt für die<br />
unerwünschten Wirkungen ebenso wie<br />
für die klinische Wirksamkeit. Die Anzahl<br />
der in klinischen Vergleichsstudien eingeschlossenen<br />
Patienten reicht jedoch nicht<br />
aus, um Aussagen über seltene unerwünschte<br />
Wirkungen machen zu können.<br />
Daher müssen weitere Auswertungen der<br />
Gesamtdaten aus mehreren klinischen Studien<br />
oder sogar die Erfahrungen aus der<br />
„postmarketing surveillance“ herangezogen<br />
werden. Die Limitierungen solcher<br />
Daten sollten jedoch stets berücksichtigt<br />
werden.<br />
Generell gilt, dass sich die unerwünschten<br />
Wirkungen der meisten, <strong>zur</strong> <strong>parenteralen</strong><br />
Therapie verordneten Antiinfektiva<br />
überwiegend an drei Organsystemen<br />
manifestieren:<br />
n Gastrointestinaltrakt (z. B. Übelkeit,<br />
Erbrechen, Diarrhö),<br />
n Haut (z. B. Exantheme, Urtikaria,<br />
Phototoxizität) und<br />
n ZNS (z. B. Kopfschmerzen, Schwindel,<br />
Schlafstörungen).<br />
Wesentliche Unterschiede bestehen<br />
im Schweregrad und der Häufigkeit einer<br />
bestimmten unerwünschten Wirkung.<br />
Nach der Pathogenese der unerwünschten<br />
Wirkungen lassen sich toxische, allergische<br />
und biologische Wirkungen unterscheiden.<br />
In manchen Fällen kann nicht eindeutig<br />
festgestellt werden, ob z. B. Störungen<br />
des Magen-Darm-Trakts durch direkte Wirkungen<br />
auf die entsprechenden Organe<br />
hervorgerufen wurden oder ob die Veränderungen<br />
durch eine Beeinflussung der<br />
bakteriellen Flora verursacht sind.<br />
Grundsätzlich ist zu bedenken, dass<br />
jede Gabe einer antimikrobiell wirksamen<br />
Substanz die körpereigene Flora<br />
beeinflusst. Art und Ausmaß der Veränderungen<br />
werden wesentlich durch die<br />
antibakterielle Wirkung und durch die<br />
pharmakokinetischen Eigenschaften des<br />
Antibiotikums geprägt. Bei jeder antibakteriellen<br />
Therapie müssen daher die biologischen<br />
Nebenwirkungen der Substanzen<br />
in der Nutzen/Risiko-Abwägung mit<br />
berücksichtigt werden.<br />
Beta-Lactam-Antibiotika<br />
Die parenteral verabreichten Beta-Lactam-<br />
Antibiotika sind im Allgemeinen gut verträglich.<br />
Die Nebenwirkungen sind in der<br />
Regel leicht und vorübergehend und erfordern<br />
nur selten einen vorzeitigen Therapieabbruch.<br />
Bei etwa 1 bis 2 % der Patienten<br />
können Überempfindlichkeitsreaktionen in<br />
Form von morbilliformen oder skarlatiniformen<br />
Exanthemen auftreten. Selten (in<br />
0,5 bis 1 %) kommt es zu Gesichts-, Zungen-<br />
oder Glottisschwellungen (z. B. Quincke-Ödem).<br />
Sehr selten sind eine Pneumonitis<br />
bzw. interstitielle Pneumonie oder<br />
eine interstitielle Nephritis. In Einzelfällen<br />
(< 0,1 %) kann es zu schweren akuten allergischen<br />
Reaktionen (Anaphylaxie bis hin<br />
zum lebensbedrohlichen Schock) kommen<br />
(dosisunabhängig), die im Allgemeinen bis<br />
zu 30 Minuten nach der Applikation auftreten.<br />
Solche Reaktionen sind nach Penicillinen<br />
häufiger als nach anderen Beta-<br />
Lactam-Antibiotika. Patienten sind nach<br />
Applikation eines Beta-Lactam-Antibiotikums<br />
für etwa 30 Minuten zu beobachten,<br />
um eine eventuell auftretende allergische<br />
Reaktion zu erkennen.<br />
Kreuzallergische Reaktionen zwischen<br />
Penicillinen und Cephalosprorinen sind<br />
eher selten. Aztreonam ist ein Beta-Lactam-Antibiotikum,<br />
das auch bei Patienten<br />
angewandt werden kann, die nach<br />
Penicillinen und anderen Beta-Lactamen<br />
Hautausschläge oder andere Arten akuter<br />
Überempfindlichkeitsreaktionen entwickelt<br />
haben, weil Kreuzallergien nach den<br />
bisherigen Erfahrungen sehr selten sind.<br />
Bei einigen Patienten wurden nach Aztreonam<br />
Allergien beobachtet, die jedoch<br />
wahrscheinlich eher mit der Struktur der<br />
Seitenkette als mit dem Beta-Lactam-<br />
Ring zusammenhängen. Da die Seitenkette<br />
identisch ist mit der entsprechenden<br />
Struktur im Ceftazidim, sollte bei einer allergischen<br />
Reaktion gegen Ceftazidim das<br />
Monobactam Aztreonam nicht verabreicht<br />
werden und umgekehrt [1, 52].<br />
Auswirkungen auf das Blutbild sind<br />
allergischer oder toxischer Art. Sie manifestieren<br />
sich gelegentlich in Form einer<br />
Thrombozytopenie und/oder Eosinophilie,<br />
selten (< 2 %) in Form von Leukopenie. Die<br />
27



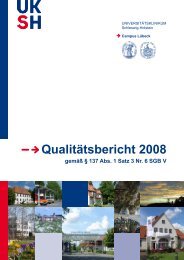



![Ausgabe Januar 2013 [pdf] - UKSH Universitätsklinikum Schleswig ...](https://img.yumpu.com/11131115/1/184x260/ausgabe-januar-2013-pdf-uksh-universitatsklinikum-schleswig-.jpg?quality=85)
![Qualitätsbericht 2011 Campus Kiel [PDF] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/9884717/1/184x260/qualitatsbericht-2011-campus-kiel-pdf-uksh-.jpg?quality=85)
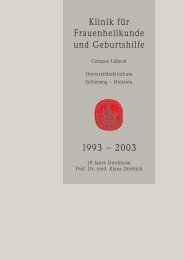

![Interdisziplinäres Symposium Inkontinenz am 24.9.08 [pdf] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/7718861/1/190x135/interdisziplinares-symposium-inkontinenz-am-24908-pdf-uksh-.jpg?quality=85)